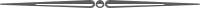Bevor das OSKAR prämierte Werk „Nomadland“ der Regisseurin Chloe Zhao in den deutschen Kinos erscheint, lesen wir das dem Film zugrunde liegende Buch „Nomaden der Arbeit“ von Jessica Bruder. Die Professorin der Columbia Graduate Journalism School widmet sich seit Jahren subkulturellen und wirtschaftlich-sozialen Phänomenen.
Für ihr Buch recherchierte sie einige Jahre über die Lebensbedingungen moderner Nomaden in Amerika und erklärt, warum immer mehr ältere Menschen in Wohnmobilen und Vans durch das Land fahren. Sie lernte dabei, dass die von ihr beobachteten Camper die Titulierung „homeless“ ablehnen. Ausgestattet mit Obdach und Transportmittel, wie sie sind, ziehen sie eine andere Wortschöpfung vor: Sie bezeichnen sich schlicht und einfach als „houseless“.
Letztendlich steht das selbstgewählte Nomadenleben für den Versuch, einem wirtschaftlichen Paradoxon zu entkommen: steigende Mieten und Niedriglöhne. Für viele Pensionäre, die im Film auftauchen, ist der Traum des bürgerlichen Lebens gescheitert. Sie sind keine sorglos umherreisende Rentner, sondern sie müssen, um über die Runden zu kommen, hart arbeiten. Trotz der Herausforderungen ihrer sozialen Lage genießen sie aber auch das alltägliche Camperleben. „Das letzte Stückchen Freiheit in Amerika ist ein Parkplatz“ schreibt Bruder.
Die Lebensgeschichte von Linda May steht exemplarisch im Mittelpunkt des Buches. May konnte sich keine Rente erarbeiten und ihre Sozialhilfe reicht nicht einmal für die Miete. Sie teilt das Schicksal vieler älterer Pensionäre in den USA. 2015 lebte jede sechste, alleinstehende Frau unter der Armutsgrenze. Bruder beschreibt das abenteuerliche Leben von Linda, die ihre Reisen im Van mit zahlreichen Gelegenheitsjobs finanziert.
Das Buch beschreibt hier „CamperForce“, ein von Amazon ins Leben gerufenes Programm zur Einstellung von Wanderarbeiter. Diese Menschen sind moderne Reisende, die zeitlich begrenzte Jobs annehmen und denen dafür von dem Unternehmen ein kostenloser Stellplatz zur Verfügung gestellt wird. Oft arbeiten die Rentner bis zur Erschöpfung und unter härtesten Bedingungen. Ihr Ziel ist, nicht obdachlos zu werden und ein freies, bescheidenes Leben zu führen. „Die Nomaden, die ich monatelang interviewt hatte, waren weder machtlose Opfer noch unbekümmerte Abenteurer“ schreibt Bruder. Und: „Sein Schicksal selbst zu wählen, war, wie sich herausstellte, ein sehr wichtiger Punkt.“
Die soziale Frage ist in den USA historisch mit dem Begriff des Vanlife verbunden. Mitte der 1930er Jahre, die Great Depression hatte Amerika fest im Griff, wurden Wohnanhänger zum ersten Mal in Massen gefertigt. Der Traum zu entfliehen und die ökonomischen Ursachen dieser Sehnsucht sind in diesem Kontext einzuordnen.
Viele „Nomaden“ bilden eine „Sippe von Umherziehenden“, schaffen virtuelle und reale Communities, um ein soziales Netz aufzubauen. Sie formen auf diese Weise eine logische statt biologische Familie. Große nationale Treffen fördern den Trend: So versammeln sich in der Wüste, in der Nähe von Quartzsite, in den Wintermonaten zehntausende Camper, um gemeinsam zu überwintern.
Die Probleme des Nomadenlebens, bis hin um den Kampf um Stellplätze sind ebenso ein Thema des Buches. „Die Regierung will, dass wir in einem Haus oder Apartment wohnen“ wird ein Influencer der Szene angesichts neuer Meldebestimmungen und anderer Restriktionen zitiert.
Der Film „Nomadland“ wurde in den Medien dafür kritisiert, die Sozialkritik des Buches zu vernachlässigen und die Geschichte der Protagonistin in eine romantisierende Bildersprache zu übersetzen. Chloe Zhao reagierte auf diese Kritik in einem Interview in der Los Angeles Times:
„Wenn man genau hinschaut, ist das Thema Altersfürsorge als Opfer des Kapitalismus in jedem Bild zu sehen“, sagt sie. „Es ist nur, ja, da ist der wunderschöne Sonnenuntergang dahinter.“
Leseempfehlung:
Jessica Bruder, Nomaden der Arbeit, Blessing Verlag