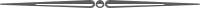„Swantow, ein Ort, der nichts und zugleich alles verspricht, der noch Zeit hat, auf den Menschen zu warten, einen ganzen Sommer wenn es sein muss.“
Wir lesen in den „Ostseetagebücher“ von Hanns Cibulka und werden von seinem Werk inspiriert eine Art Zeitreise anzutreten. Der Schriftsteller hat 1982 mit „Swantow“ einem kleinen Dorf bei Poseritz ein Denkmal gesetzt. Das Tagebuch berichtet von einer fiktiven Beziehungsgeschichte, den Eindrücken, Erinnerungen und Gedanken des Erzählers, eingebettet in das dörfliche Idyll und in die Landschaft Rügens. Wie alle Besucher der Insel beschäftigt sich der Protagonist Andreas mit dem Meer, dem Himmel und dem einmaligen Licht auf der Insel. „Die Landschaft auf Rügen ist ein atmosphärisches Phänomen, hier wird man sich des Lichtes wieder bewusst.“
Zu DDR-Zeiten war das Buch eine Provokation, denn Cibulka romantisiert nicht die Insel, stellt nicht nur ihre wunderbaren Seiten vor, sondern beschreibt ebenso die Phänomene der Umweltverschmutzung. In Sichtweite des Dorfes ist die Silhouette des ehemaligen Kernkraftwerkes Lubin, auf der anderen Seite des Boddens, erkennbar. Der Autor ahnt, dass der moderne Wohlstand und das Versprechen des ewigen Wachstums auf Sand gebaut sind.
In einen sogenannten Lagebericht, verdichtet er die Lage wie folgt: „Wir, die Unzufriedenen, die im Überfluss leben, wir, die auf Wert und Gegenwert aus sind, wir, die alles besitzen, von dem unsere Väter nur geträumt, plötzlich stehen wir da, mit zu wenig Dasein in der Hand.“
Andreas weicht vor dem Riesenhaften der Technik zurück und beschäftigt sich mit einem Wespenbau in seiner Wohnung. Die Landschaft, die er liebt und die langsam ihre archaische Ursprünglichkeit verliert, ist eine Spiegelung seines inneren Zustandes. „Die inneren Spannungen, die eine solche Umwelt auslöst, gehen an keinem Menschen vorbei, sie übertragen sich auf sein Denken und Fühlen“. Nicht zuletzt ist es der Tod, so stellt Andreas im Gespräch mit seiner Gefährtin fest, den die moderne Gesellschaft verdrängt. Die „Ostseetagebücher“ sind Dokumente einer inneren und äußeren Reise, die immer wieder an die Sinnfrage erinnern.
Zeitsprung: 40 Jahre nach dem Erscheinen des Buches spazieren wir alleine auf der einzigen Strasse, die durch Swantow führt und überlegen, ob und wie sich der Ort – im Vergleich zu den Beschreibungen der Tagebücher – verändert hat. Die Gärten sind gepflegt, es riecht nach Lavendel, die meisten Häuser sind vorbildlich herausgeputzt. Vielleicht ein Unterschied zu früher: Man kann sich hier auf Zeit einmieten, aber – die Grundstückspreise auf Rügen sind berüchtigt – nicht ansäßig werden. Und wer von den Bewohnern, die das Privileg geniesen hier zu leben, würde dieses Dorf verlassen?
Am Ende der Straße steht die alte Kirche, deren Fundament aus Findlingen und Steinen gebaut wurde. Die Slawen nannten diesen Ort „Swetgora“ – heiliger Berg. Ein Ruhepol. Die Gräber, die unter den schattigen Bäumen liegen, trotzen der Zeit, auch wenn die Namen derjenigen, die hier begraben sind, längst verwittert sind.
Der ganze Raum stimmt den Besucher ein, entfaltet einen Klang. Im Sommer finden hier Konzerte statt. Die Titel des aktuellen Programmes, „Vom Verschwinden“, „Meermusik“ oder „Beethoven – Welten des Ausdruckes“, entfalten Ihre eigene Poesie.
Wir gehen am Pfarrhof vorbei durch einen Wald zu einer Bank. Man sieht hier keine der Sehenswürdigkeiten, die Rügen berühmt gemacht haben. Es ist ein weites Feld.
Das Tagebuch eines Sommers schließt Anfang Oktober mit folgendem Eintrag:
„So vieles wurde auch diesen Sommer noch nicht gesagt, man wird wiederkommen müssen, weil auch das Ungesagte auf den Menschen wartet..“
Literatur: Hanns Cibulka, Ostseetagebücher, NOTschriften Verlag