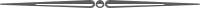Millionen von Touristen besuchen Florenz mit großen Erwartungen, weil die Stadt ein wahres Juwel der Renaissance ist und eine unglaubliche kulturelle und künstlerische Bedeutung hat. Die Stadt war im Mittelalter und in der Renaissance ein Zentrum von Macht, Handel und Kultur – die Medici-Familie spielte dabei eine große Rolle. Die Altstadt mit ihren engen Gassen, Brücken wie der Ponte Vecchio und charmanten Plätzen wirkt wie ein lebendiges Museum.
Wir stehen dicht gedrängt in einem lokalen Bus, der uns ins Zentrum bringt. Auf der Fahrt hören wir die erregte Stimme eines älteren Herrn, der, in gebrochenem Englisch, die Lage aus seiner Sicht auf den Punkt bringt: „es gibt zu viele Touristen! Wir bezahlen Steuern und dann bekommen wir immer nur einen Stehplatz!“ Darauf folgen einige, vermutliche weniger sachlich formulierte Einwände, auf Italienisch. Im öffentlichen Verkehrsmittel herrscht angesichts des Wutausbruches betretenes Schweigen. „Mamma Mia, der Mann hat recht, die Stadt ist überfüllt“ denkt nur der Verständige. Der Zeithistoriker Joachim Fest hat das Phänomen des Massentourismus gut erklärt: früher wurden die Besucher durch eine Stadt verändert, heute verändern sich nur noch die Touristenziele.
Nach der Ankunft in der Altstadt schwimmen wir im Strom und bewundern im Vorbeigehen die vergangene Größe, die sich überall in erstaunlichen Bauwerken in Erinnerung bringt. Der geplante Besuch der Uffizien, Standort berühmter Kunstwerke, fällt allerdings aus. Die Schlangen vor den Kassen sind uns einfach zu lang.
Immerhin laufen wir so nicht in Gefahr in das Stendal-Syndrom zu verfallen. Das psychosomatische Phänomen, das vor allem bei Touristen in Städten mit besonders hoher Dichte an Kunstwerken und kulturellen Eindrücken auftritt – ist besonders bekannt in Florenz. Menschen, die am Stendal-Syndrom leiden, reagieren körperlich und emotional extrem auf den Anblick großer Kunstwerke oder überwältigender kultureller Schönheit. Die Symptome können beinhalten: Herzrasen, Schwindel, Ohnmacht, Angstzustände und sogar depressive oder manische Zustände!
Benannt ist das Syndrom nach dem französischen Schriftsteller Stendal, der 1817 Florenz besuchte und beim Anblick der Fresken in der Kirche Santa Croce ein intensives Gefühl von Ehrfurcht, Rührung und körperlicher Erschöpfung beschrieb. Seine Reaktion gilt heute als eine der frühesten dokumentierten Fälle des Syndroms. In Florenz gibt es sogar eine psychiatrische Klinik, die Touristen mit entsprechenden Symptomen behandelt!
Nur wenige Besucher treffen wir im Dante Haus an. Der Dichter und Philosoph Dante Alighieri (1265-1321) ist das berühmteste Kind der Stadt. Seine „göttliche Komödie“ – in italienischer Sprache verfasst, gehört zu den Klassikern der Weltliteratur. Das Buch beschreibt Dantes Reise durch die Reiche des Jenseits und stellt allegorisch die Wanderung der Seele zu Gott dar. Der Dichter versetzt, ohne großes Zaudern, einige griechische Philosophen, historische Größen und nicht-christliche Religionsführer in die Hölle. Wir spazieren durch die Räume des Museums, in dem es eigentlich nicht viel zu sehen gibt. Beeindruckend ist die Vielzahl der ausgestellten Übersetzungen, die sein Hauptwerk in dutzenden verschiedenen Sprachen lesbar macht. Daraus kann man schließen, dass die Faszination des Buches, mit seiner religiösen Thematik, bis heute ungebrochen weiterwirkt.
Wir beschließen unseren Besuch im überfüllten Florenz eher kurz zu halten, ganz nach dem Vorbild Goethes, der auf seiner Reise dem Gesamtkunstwerk nur wenig Zeit widmete, zu groß war seine Ungeduld endlich in Rom anzukommen. Nur ein weiteres Ziel streben wir noch an. An den großen Palästen vorbei machen wir uns auf den Weg zum Palazzo Pitti, wo wir uns die hinter dem Palast liegende Gartenanlage „Giardino di Boboli“ ansehen wollen. Hierher flüchtete sich auch gelegentlich der Dichter Rainer-Maria Rilke, der seinen Aufenthalt in der Stadt mit gemischten Gefühlen erfuhr. „Fast feindlich heben die Paläste ihre stummen Stirnen entgegen“ schrieb er im Tagebuch. Ohne seine Geliebte Lou Andrea Salomé fühlte er sich einsam und die Anwesenheit zahlreicher Berühmtheiten schüchterten den unsicheren, jungen Künstler ein. Auf seinem Spaziergang begegnete ihm zufällig der Dichter Stephan George, der dem jungen Mann seine Überlegenheit spüren ließ. Rilke kommentierte später lapidar: „Künstler sollten einander meiden (…) Zwei Einsame sind aber eine große Gefahr füreinander.“
Wir schlendern unter unserem Regenschirm durch einen der bedeutendsten italienischen Gärten der Renaissance. Er wurde im 16. Jahrhundert von der Familie Medici angelegt und diente als Vorbild für viele europäische Barockgärten. Man ist hier fast alleine. Der weitläufige Garten, mit seinen kunstvollen Skulpturen, Brunnen, Grotten und geometrisch angelegten Wegen, beeindruckt uns. Am Ende unseres Rundgangs hört es auf zu regnen und wir genießen den Ausblick auf die Stadt und die Vorfreude auf die Weiterreise.
Literatur:
Birgit Haustedt, Rilke in Italien, Insel Verlag, Berlin 2025