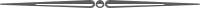Wir flanieren über die Brühlsche Terrasse und schauen auf die stumm dahinfließende Elbe. Hier, vom Balkon Europas aus, taucht man in die große Geschichte dieser Stadt ein, die sich in aller Widersprüchlichkeit vor uns ausbreitet. „Dresden ist ein langer Blick zurück, Gegenwart nur die Wasseroberfläche der Vergangenheit die steigt und steigt“ schreibt der Schriftsteller Uwe Tellkamp in seinen Erkundungen. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist das Stadtbild von Zerrissenheit geprägt. In Sichtweite die berühmten Bauwerke, Theater, Oper, Museen, die an den Mythos des untergegangene Elbflorenz erinnern und erst mit dem Blick auf die angrenzenden Wohnsilos der allgegenwärtigen DDR-Architektur, das ganze Bild ergeben.
Hinter uns liegt ein Symbol der Versöhnung, die Frauenkirche, die, zusammengesetzt aus neuen und von Ruß geschwärzten Steinen, das alte Zentrum wieder aufleben lässt. Am Tag der Luftangriffe vom 13. Februar 1945 hielt sich der Nobelpreisträger Gerhart Hauptmann in einem örtlichen Sanatorium auf. Die Zerstörung seiner über alles geliebten Kulturmetropole bildet den Tiefpunkt seiner Existenz: „Wer das Weinen verlernt hat, lernt es wieder beim Untergang Dresdens. Ich stehe am Ausgangstor meines Lebens und beneide meine toten Geisteskameraden, denen dieses Erlebnis erspart geblieben ist.”
Ein Aufenthalt in dieser Stadt genügt nicht. Allein 50 Museen kann man in Dresden besichtigen. Wir besuchen das Albertinum und bewundern dort die neuen Meister. Im ersten Saal stehen wir vor der Fotofassung der berühmten 48 Portraits, welche Gerhard Richter nach Gemälden fertigte, die er 1972 auf der Biennale in Venedig zeigte. Wissenschaftler, Künstler und Politiker sind in leicht verwaschenem Grau gehalten. Eine Deutung: Im Dschungel der Narrative verblassen langsam die Erinnerungen an die großen Charaktere. Wer erzählt ihre Geschichten?
Wir verlassen die Innenstadt und fahren an der Elbe entlang, die über eine kühne Stahlkonstruktion, das blaue Wunder, überquert wird. Wir sind im Stadtteil Loschwitz. Dort finden wir die kleine, aber feine Buchhandlung, die, eine Art Symbol, im Mittelpunkt aktueller Kontroversen steht. Im Schaufenster ist das neueste Werk Tellkamps ausgestellt: der Schlaf in den Uhren. Die bekannte Buchhändlerin und der mit ihr befreundete Schriftsteller gehörten zum Kernbestand der Kulturszene Dresdens. Ihre kritischen Einlassungen im Rahmen der Flüchtlingskrise 2015 hat sie in das geistige Zentrum der Debatten über die AfD und die PEGIDA geführt.
In der hitzigen Kontroverse wurde den beiden Protagonisten vorgeworfen, sich nicht eindeutig von rechtsextremen Positionen abzugrenzen. Tellkamp beklagt sich seitdem über einen angeblichen Gesinnungskorridor, der dazu führt, dass Meinungsäußerungen zwar erlaubt, aber – aus seiner Sicht – immer häufiger zu einer sozialen Ächtung führen. Die Fronten im Kulturkampf sind verhärtet, die Buchhandlung wurde sogar Ziel eines perfiden Anschlages.
Jenseits der politischen Debatte gehört Uwe Tellkamp zweifellos zu den großen Schriftstellern des Landes. Der Turm, ein Roman über die letzten Jahre der DDR, ist ein Bestseller und wurde erfolgreich verfilmt. Schauplatz der Familiengeschichte und Ziel unseres Besuches ist der Stadtteil „Weißer Hirsch“, zu dem man, in unmittelbarer Nähe des Buchladens, mit einer Bergbahn aufsteigt. Der Gang durch das Villenviertel und die Erinnerungen an das Buch, mit seinen fiktiven und realen Schilderungen, verschmelzen hier. Die Häuser und die BewohnerInnen, viele aus der Kunst- und Wissenschaftsszene, sind Inspirationsquellen für das Werk. Die finanzkräftigen Bauherren ließen ihrer architektonischen Phantasie freien Lauf und so entstand an diesem Ort eine Art Turmgesellschaft, die in DDR-Zeiten am deutschen Bildungsbürgertum festhielt.
Auf hunderten Seiten beschreibt Tellkamp diesen Ausschnitt der neueren Geschichte Dresdens. Den Autor selbst stimmt die Zukunft der großen Narrative unter den Bedingungen moderner Informationsgesellschaft eher pessimistisch. In einem Gespräch mit dem FAZ-Redakteur Andreas Platthaus, mit dem er 2008 den Weißen Hirsch besucht, stellt er fest: „Heute wird gar nicht begriffen, was Romane leisten können. Dass sie einen Zugang zur Welt bieten, den Geschichtsbücher oder Philosophie gar nicht leisten können. Ich habe keine große Hoffnung für Bücher wie meines, die Zahl der Leser, die damit etwas anfangen können, wird immer kleiner.“
Wir lassen den Tag in der Dresdner Neustadt ausklingen. Die elitäre Stimmung auf den Hügeln über der Elbe ist hier weit weg. In dem Szene- und Ausgehviertel finden sich zahlreiche Cafés und Kneipen. Das Publikum ist bunt. Die Galerien, Theater und Kinos tragen zu der so weitläufigen wie einmaligen Kulturszene der Stadt bei.
Literatur:
Uwe Tellkamp, Die Schwebebahn. Dresdner Erkundungen, Insel Verlag, 2012