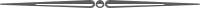In Weimar besuchen wir eine Ausstellung im Haus der Weimarer Republik und erinnern uns an eine geschichtliche Erfahrung: die Hyper-Inflation 1923. „Nichts hat das deutsche Volk – dies muss immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden – so erbittert, so hasswütig, so hitlerreif gemacht wie die Inflation“ schrieb Stefan Zweig in seiner Erinnerungen über die Welt von gestern. Die Regierungen der Weimarer Republik, finanziell von gigantischen Kriegsfolgelasten geplagt, sahen keinen anderen Weg, als die Finanzierung mit dem Gelddrucken zu gewährleisten. Nach Angaben der Reichsbank zirkulierten am Ende der Hyper-Inflation rund 496 Trillionen in regulären Banknoten. Im November 1923 war die Währung völlig zerrüttet und ein Brot kostetet über 800 Milliarden Mark. Im letzten Jahrhundert rettete die Einführung der Rentenmark die Weimarer Ökonomie, bevor dann 1929 die Weltwirtschaftskrise, Bankenpleiten und Massenarbeitslosigkeit Millionen Deutsche zu Beginn der 1930er Jahre endgültig in die Arme der Nationalsozialisten trieb.
Das Trauma dieser Erfahrungen und die Erkenntnis, dass die Ökonomie Teil des Schicksals ist, reicht bis in die Gegenwart. In der verschärften Inflation seit Ausbruchs des Ukraine-Krieges ist es der enorme Anstieg der Rohstoff- und Energiekosten, der die Preise wieder steigen lässt. Viele BürgerInnen im Land beklagen die Auswirkungen der Teuerung in ihren Geldbeuteln. Auf dem Rundgang durch die Sonderausstellung 1923 in Weimar werden wir hinsichtlich sich andrängender Parallelen beruhigt. Auf den Schautafeln der Ausstellung werden die Unterschiede zur Vergangenheit und die noch beherrschbaren Inflationsraten in der aktuellen Krise betont. Aber, angesichts der Polarisierung der Menschen, den wachsenden Schulden und der steigenden Bedeutung der Rechtspopulisten werden die Vergleiche zu den Weimarer Verhältnissen immer wieder bemüht. Und, man wird daran erinnert, dass viele gesellschaftliche Konflikte sich mit den Mitteln einer florierenden Wirtschaft leichter abfedern lassen. Wie die Verteilungskämpfe der Bundesrepublik sich unter den Vorzeichen echter ökonomischer Zerrüttungen gestalten, bereitet nicht nur uns starke Kopfschmerzen.
Die Diskussionen über die Werthaltigkeit des Geldes und die – typisch deutsche – konservative Haltung gegenüber der Verschuldung, hat eine lange Tradition. Im Jahr 2012 erinnerte der ehemalige Präsident der Bundesbank, Jens Weidmann, an den traditionellen Kontext der ökonomischen Grundhaltung der Bevölkerung. Für den Banker erkannte bereits Goethe das Kernproblem der Geldpolitik. Der Dichter hatte in seiner Zeit das Dilemma der Heutigen, auf Papiergeld fußenden Wirtschaft analysiert und literarisch festgehalten. Weidmann beeindruckt, dass der Finanzminister des Fürstentums den potenziell gefährlichen Zusammenhang von Papiergeldschöpfung, Staatsfinanzierung und Inflation – und somit den Abgrund ungedeckter Währungsordnungen – in Faust II beleuchtet.
Das Thema scheint uns in diesen Tagen wieder einzuholen. Über Jahre hielt die Bundesregierung die schwarze Null. Coronapandemie, Ukraine-Krieg und Energiekrise zwangen dem Staat zur Aufnahme von Rekordsummen. Die deutschen Staatsschulden sind im Jahr 2022 um 71 Milliarden auf 2,57 Billionen Euro gestiegen. Ob ein Weg zum nachhaltigen Wohlstand ohne Rücksicht auf die Neuverschuldung gelingt, ist eine der großen Glaubensfragen unserer Zeit.
Es ist wichtig, die psychologische Seite im Kontext ökonomischer Dynamik zu verstehen, die unseren Alltag mehr denn je prägt. Hans Binswanger erklärt in seinem Buch „Geld und Magie“ das Dogma der Moderne: Das Wachstum der Wirtschaft ist der Maßstab für die Entwicklung der Menschheit. Der Ökonom versteht die Geldwirtschaft im Sinne eines alchemistischen Prozesses: die Suche nach dem künstlichen Gold mit anderen zeitgemäßen Mitteln. Die wundersame Geldvermehrung hat an ihrer Strahlkraft bis heute wenig verloren. Unter der permanenten Notwendigkeit des ökonomischen Wachstums wächst die zunehmende Unfähigkeit, den Reichtum, den man erzeugt, zu genießen. „Der Investor ist daher in höchstem Maße durch die Sorge über die künftige Entwicklung der Wirtschaft geplagt. Nie kann er sich mit der Gegenwart zufriedengeben. Er wird vielmehr prognosesüchtig. Er hält nach allen Arten von Prophezeiungen Ausschau und fühlt sich ständig von Unglücksbotschaften bedroht.“
Aus diesem Phänomen erklärt sich unsere Unfähigkeit, aktuelle Ereignisse in ihrer Bedeutung, länger ins Visier zu nehmen, da sich am Horizont stets neue, größere, bedrohlichere Szenarien abzeichnen. Die sozialen Medien verstärken den Eindruck kurzer Verfallszeiten menschlicher Aufmerksamkeit, sei es in den Modi der Empörung, Nachdenklichkeit oder Betroffenheit. Hoch im Kurs stehen heute Sender mit großen Reichweiten, die Emotionen und simple Botschaften unter das Volk streuen.
Es gehört zur Tragik unserer Zeit, dass die Volkswirtschaften hohe Summen nicht in wichtige Zukunftsprojekte investieren, sondern unter dem Druck der Verwerfungen in die Bewältigung destruktiver Krisen verschwenden. Goethes Faust suchte den Ausweg durch den Fortschritt in die selbst geschaffene, in die alchemistische Lehre der Geld- und Wertschöpfung, von der die Sorge ausgeschlossen scheint, weil in ihr die Begrenzung der Welt und der Zeit aufgehoben ist. „Wir leben die Überzeugung des modernen Menschen, er könne alle negativen Folgen der Technik und des wirtschaftlichen Wachstums mit immer noch mehr Technik und immer noch mehr wirtschaftlichen Wachstum überwinden“ schreibt Binswanger. Die Idee eigener Machtvollkommenheit lässt uns den grenzenlosen Schöpfungsprozess selbst fortsetzen. Darüber hinaus schafft das Vermögen, gigantische Geldmengen aus dem Nichts zu schaffen, gewaltige Machtoptionen: Finanzierbar werden Programme zur Sozialversorgung, zum ökologischen Umbau und neue Rüstungsprojekte zur Absicherung geopolitischer Interessen. Der Preis für diese Strategie ist hoch, denn den Fortschritt aufzuhalten oder mit dem aktuellen Zustand abzuschließen wird zur Illusion. Die Maxime lautet letztlich, mangels nachhaltiger Alternativen: weiter so.
Ironischerweise ist es in diesen Tagen das Bundesverfassungsgericht, das der Dynamik der Geldschöpfung einen Riegel vorschiebt und an die grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse erinnert. Die Regierung hatte mit einem Buchungstrick 60 Milliarden Euro, ursprünglich für die Bewältigung der Corona-Krise vorgesehen, in einen anderen Topf verbucht und damit den Klima- und Transformationsfonds finanziert. Jetzt fehlt das Geld an allen Enden, um eine Metamorphose einzuleiten, die in ihrem Ausmaß einer industriellen Revolution gleicht. Die Karlsruher Richter zwingen die Politik zu einem kurzen „Augenblick verweile“.
Politiker wie Robert Habeck befürchten, dass die altmodische Bremse die Mission des ökologischen Umbaus und die Abfederung ihrer sozialen Folgen an Finanzierungsfragen scheitern lässt. Statt von langfristiger Haushaltspolitik ist von Notlage und Ausnahmezustand die Rede. Die Vision, die Bundesrepublik von der Abhängigkeit von Gas- und Ölimporten zu befreien und auf alternative Energie umzustellen ist das Jahrhundertprojekt des Landes. Die Regierung steht unter hohem Druck. Im Moment hält sich die Koalition zwischen Grünen, Sozial- und Freidemokraten trotz des Gegenwindes. Es ist weniger die Sympathie der Koalitionäre und eine gemeinsame Überzeugung, die das Bündnis zusammenhält und Neuwahlen verhindert, sondern die Aussicht auf Weimarer Verhältnisse, die sich in den Wahlerfolgen der neuen Rechten im Land zeigen.
Hier schließt sich der Kreis, ökonomische Probleme und das Schüren von Ängsten sind der ideale Nährboden für das Erstarken von Populisten.