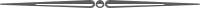Wenn man nach der Überfahrt in Vitte die Insel Hiddensee betritt, dann stellt sich bei uns recht unmittelbar das Gefühl der Gelassenheit ein. Hier herrscht kein hektischer Verkehr und Anfang November gibt es kaum Besucher. Der Reisende entscheidet entweder mit dem Pferdewagen, dem Fahrrad oder zu Fuß die Insel zu erkunden. Nur wenige Autos und Versorgungsfahrzeuge sind hier zugelassen.
Wir wandern am westlichen Strand entlang nach Kloster und lassen die einmalige Atmosphäre der Insel auf uns wirken. Die See und die Weiden, mit dem Höhenzug des Dombuschs im Hintergrund bilden eine der schönsten Landschaften, die wir kennen.
In Kloster lohnt sich ein Besuch des Heimatmuseums, das die Geschichte und Gebräuche dieses Landstriches erklärt. Erste Reiseberichte über das karge Leben auf der Insel werden im 19. Jahrhundert veröffentlicht. Ludwig Kosegarten, Schriftsteller und Dichter, der von 1792 bis 1808 Pfarrer in Altenkirchen (Rügen) war, rühmte die Landschaft in seinen Erzählungen. Anfang des 20. Jahrhunderts wird Hiddensee zur Künstlerkolonie. Das Museum informiert über die Aufenthalte der KünstlerInnen, MalerInnen und SchriftstellerInnen.
Es ist der Nobelpreisträger Gerhart Hauptmann, der zum Mythos dieses Ortes beiträgt. 1885 betrat er die Insel zum ersten Mal, 1930 kaufte er das Haus Seedorn, das heute eine Gedenkstätte ist. 1946 wurde er auf dem Inselfriedhof begraben.
Dem Dichter gelingt es die Charakteristik und den Zauber der Insellandschaft in Worte zu fassen. In seinem Drama „Gabriel Schillings Flucht“ schreibt er zum Beispiel: „Diese Klarheit! Dieses stumme und mächtige Strömen des Lichts! Dazu die Freiheit des Wanderns über die pfadlose Grastafel. Dazu der Salzgeschmack auf den Lippen. Das geradezu bis zu Tränen erschütternde Brausen der See.“
1896 fügt er in seinem Tagebuch über das Wesen der Insel hinzu: „Alles Gekünstelte, alles Städtisch-kulturell-aufgedrängte fällt von ihr ab. Das ist das Gesuchte, das ist das Gesunde. Aber eingeschläfert sind darum unsere Nerven nicht. Im Gegenteil sonderbar aufgestört.“
Die Wirkung der Landschaft, die Polarität zwischen Land und Meer, Licht und Schatten, Leben und Untergang beschäftigen ihn hier unentwegt: „Sind es die Lichtkräfte des Mondes in der selig befriedigten Unendlichkeit der See, die einen sanft-seligen Tod vorspiegeln?“
Drei Jahre später ahnt er bereits, nicht zuletzt wegen seiner Anwesenheit, seines eigenen Ruhms, dass das Idyll gefährdet ist. „Hiddensee ist eins der lieblichsten Eilande, nur stille, stille, daß es nicht etwa ein Weltbad werde!“
Zum Mythos der Insel, wie Hauptmann formuliert, dem geistigsten der deutschen Seebäder, trägt 1924 der gemeinsame Aufenthalt mit der Familie Mann bei. Im Hotel treffen sich die Meister der Sprache, der große Schriftsteller und der große Dichter. Katja Manns Erinnerungen lassen eine Rivalität anklingen: „Unsere Nachbarschaft in Hiddensee war etwas ärgerlich, weil Hauptmann doch der König von Hiddensee war.“
Uns fasziniert Hauptmanns Art zu reisen. Sein Freund Arnold Gustavs, langjähriger Pfarrer von Hiddensee, begründet die Unruhe des Dichters, der immer wieder zwischen Italien, dem Riesengebirge und der Ostsee pendelt. „Spürte er, daß der Strom seines Geistes am Versiegen war, packte er seine Koffer und fuhr an einen anderen Ort. Und siehe da die Quelle begann wieder zu sprudeln.“
Die imaginäre Kraft des Schriftstellers, durch sein Reisen stimuliert, bezeugt sein Roman „Die große Mutter“, der in der Südsee spielt, aber offensichtlich Hiddensee ein Denkmal setzt. Gerhart Hauptmann schrieb das Werk 1916 bis 1924 größtenteils in Kloster. Er erwähnt diesen Umstand augenzwinkernd in seinem Tagebuch und lässt wissen, dass er die Geschichte nur schreiben konnte, weil er „jahrelang auf Hiddensee die vielen schönen, oft ganz nackten Frauenkörper gesehen hatte.“
Ein paar Zeilen aus einem seiner letzten Gedichte, die der Insel gewidmet sind, verweisen auf seine Einsamkeit, Melancholie und die menschliche Erfahrung über das verlorene Paradies:
Dann kam der Lärm,
Ein buntes Geschwärm:
entbundener Geist,
verdorben, gestorben, zu allermeist.
Und nun leben wir in fremdmächtiger Zeit,
verschlagen wiederum in Verlassenheit,
in meines Hauses stillem Raum
herrscht der Traum.
Wir setzen unseren Spaziergang von Kloster zum Leuchtturm auf dem Dornbusch fort. Hier verliert sich der Blick in die Weite, das Licht verändert sich im Minutentakt, in der Ferne sieht man Pferde und Kühe auf den Wiesen grasen. Es ist eine Welt, die sich vor uns ausbreitet, die ein eigenes Maß auszeichnet. Der Horizont von Raum und Zeit bildet die Kulisse. Die Stimmung setzt sich ab gegenüber der Hektik des Festlandes, und gewährt, solange man hier ist: Erholung. Thomas Mann hat recht: „Das Meer ist keine Landschaft, es ist das Erlebnis der Ewigkeit.“