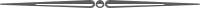Berlin ist eine Großstadt ohne Zentrum. Wir erkunden die verschiedenen Stadtteile mit dem Auto, der Straßenbahn und zu Fuß. Wir laufen durch Parks und Grünanlagen, fahren auf Betonpisten an Wohnsilos vorbei, erleben die kleinstädtische Atmosphäre im Kiez, bewundern die Prachtstraße Unter den Linden und flanieren durch die Konsumtempel. Irgendwo zwischen Gropiusstadt und Grunewald, Charlottenburg und Marzahn fragen wir uns, ist Berlin, oder was man Berlin nennt, eigentlich eine schöne Stadt?
Wenn Cees Nooteboom Recht hat, dass eine Stadt wie ein Buch ist, und der Reisende sein Leser, dann ist diese Metropole mit all ihren verschiedenen Seiten keine Kurzgeschichte. Es gibt so viele Ansichten auf diese Metropole, dass sich eine gewisse Reizüberflutung einstellt, die sich aus dem Übermaß des Angebots und der Flut von Menschen, seien es Passanten, Konsumenten, Arbeitende, Touristen oder Flüchtlinge ergibt. Ein Gang durch die Straßen sammelt unzählige Augenblickseindrücke, die wir – vermutlich unbewusst – in unser Bild von der Stadt einordnen. Der Eindruck von Schönheit und Trostlosigkeit wechselt sich dabei ab. Aber, Berlin, Gott sei Dank, bietet dem Wanderer immer wieder seine Ruhepole an, eine Bank im Park, in den kleinen Cafés oder irgendeiner anderen ruhigen Ecke.
Natürlich muss man sich auf dieser Art des Reisens, die fortlaufende Bewegung erfordert, einem bekannten Dilemma stellen. Der Philosoph Giorgio Agamben beschreibt es so: „Der zeitgenössische Mensch kehrt abends nach Hause zurück, und ist völlig erschöpft von einem Wirrwarr von Erlebnissen – unterhaltenden oder langweiligen, ungewöhnlichen oder gewöhnlichen, furchtbaren oder erfreulichen, ohne daß auch nur eines davon zur Erfahrung geworden wäre.“
Der Philosoph mag Recht haben, aber unser Stadtrundgang zeigt die andere Seite der Medaille. Berlin ist ein Erfahrungsort, ein großes Mahnmal, in der sich die machtvolle Begegnung von abgründigen und hoffnungsvollen Geschichten, Siege und Niederlagen, manifestiert. Wir Zeitgenossen, an Frieden und Wohlstand gewöhnt, sind hier nur stille, im Grunde dankbare Beobachter, die das ungeheure Leid vergangener Zeiten nur erahnen. Zumindest mit dieser Einsicht nehmen wir eine Erfahrung mit.
In unmittelbarer Nachbarschaft des Gropiusbaus, in der wir eine Ausstellung besuchen, entdecken wir Reste der Mauer und ein Museum, das sich der „Topographie des Terrors“ widmet. Die Trennung von Ordnung und Ortung, die der Jurist Carl Schmitt, als Wesenszug des Nihilismus definiert, wird hier dramatisch erfahrbar. Die Organisation der Ideologie schuf diese Orte ohne Recht, denen man auf dem Berliner Stadtgebiet immer wieder begegnet. Für das Grauen wurde ein Preis bezahlt: Die Wunden der Vergangenheit, die ehemaligen Grenzen, die Bausünden und die oft planlos erscheinende Stadtentwicklung ergeben bis heute ein Bild der Zerrissenheit. Die moderne Architektur, die den Ost- und Westteil der Stadt zusammen wachsen lässt oder Baulücken füllt, folgt in den meisten Fällen nur dem ökonomischen Kalkül der effizienten Nutzung.
Der Ethnologe Marc Augé bietet eine begriffliche Unterscheidung an, die den Blick auf die moderne Großstadt tiefer fassen lässt. In seinem Essay „Nicht-Ort“ beschreibt er die Zunahme von sinnentleerten Funktionsorten, wie beispielsweise Flughäfen, U-Bahnen, Flüchtlingslager, Supermärkte oder Hotelketten. Es handelt sich um keine anthropologischen Orte, man ist nicht heimisch in ihnen, sondern es sind Phänomene des Ortlosen. Der Aufenthalt darin stiftet weder eine individuelle Identität, erinnert nicht an eine gemeinsame Vergangenheit und bildet keine sozialen Beziehungen: Hier erfährt man Einsamkeit und Gleichförmigkeit. „Der Raum des Reisenden“ schreibt Augé, „wäre also der Archetypus des Nicht-Ortes“. Diese rastlose Bewegung hat kein anderes Ziel als ihn selbst – oder das Schreiben, dass die Bilder festhält und wiederholt.
Auf unserem Spaziergang durch die neue Mitte am Potsdamer Platz, entstanden in der Wildwestzeit der frühen 90er, denken wir darüber nach, ob es sich hier um einen dieser beschriebenen Nicht-Orte handelt. Es ist ein belebter Stadtteil, rund um einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt angeordnet. Hier finden sich Hotels, Kinos und die Hauptzentralen diverser Unternehmungen. Wir besuchen das Sony Center, mit seiner weit sichtbaren Dachkonstruktion, die einen japanischen Berg symbolisiert und eine spektakuläre Ingenieurleistung darstellt. Das aufgefächerte Zeltdach aus Stoffbahnen ist mit Zugankern an einem Stahlring befestigt, der auf den umliegenden Gebäuden aufliegt.
Im darunter liegenden Hauptraum, dem sogenannten Atrium, strömen die Besuchermassen in die Kinos, Museen und Wohnungen der riesigen Anlage. Der Begriff kommt möglicherweise vom lateinischen ater, was so viel wie rauchgeschwärzt bedeutet. Hier befand sich ursprünglich der aus einer offenen Feuerstelle bestehende Herd, der die Decke schwärzte. Die Örtlichkeit diente als Speiseraum, Arbeitsraum der Frauen und Aufenthaltsraum der Hausbewohner. Im Sony Center wird die Halle von einem groß dimensionierten, flackernden Bildschirm dominiert, um den sich die Zuschauer versammeln und die Werbung und Beiträge der Unterhaltungsindustrie anschauen. Das Gebäude, das in dieser Form in jeder Großstadt der Welt stehen könnte, ist in die globale Ordnung des Internets eingebunden.
Die Rückbindung an die Berliner Vergangenheit wird hier durch eine architektonische Kuriosität gewährleistet. Wie in einem Schaukasten sind Säle des alten Hotels Esplanade in das Ensemble integriert. Der Palast war zu Beginn des letzten Jahrhunderts ein sozialer Treffpunkt für den den Kaiser, Politiker und Künstler. In seinen Erinnerungen staunt der Schriftsteller Cees Nooteboom über den Anblick:
„Hinter Glas etwas vom früheren Kaisersaal, aber es ist so ähnlich wie der zweifache Tod aufgespießter Schmetterlinge in einer Vitrine, sie hätten sich längst aufgelöst haben müssen, doch sie sind noch da. Nur fliegen können sie nicht mehr.“
Auf unserem Heimweg stellt sich von zahlreichen Eindrücken eine Erschöpfung ein. Sind wir der Gestalt dieser Stadt näher gekommen? Die Antwort lautet natürlich nein, gerade deswegen lohnen sich für uns weitere Expeditionen durch den Großstadtdschungel.
Literatur:
Marc Augé, Nicht-Orte, CH Beck Verlag, 2019
Cees Nooteboom, Berlin 1989/2009, Suhrkamp Verlag, 2009