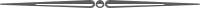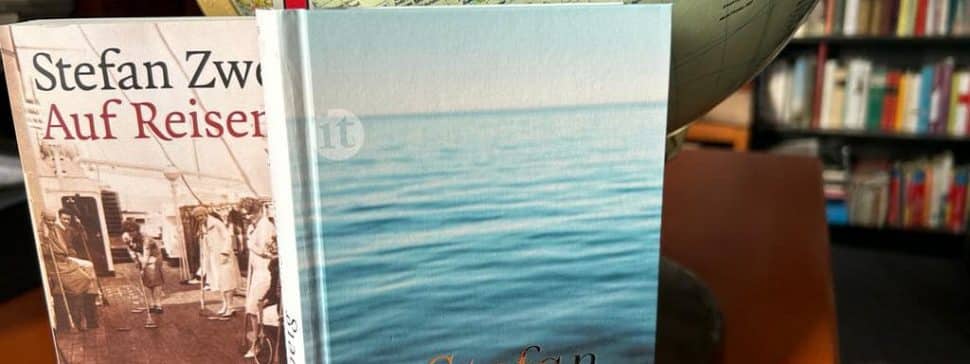Im Jahr 1926 hinterlässt der Schriftsteller Stefan Zweig mit seinem Text „Reisen oder Gereist-Werden“ ein Plädoyer für das Individualreisen. Bahnhöfe und Häfen erwecken seine Leidenschaft, aber, wie er erkennt, die Zeit ist gekommen für ein „anderes Reisen, das Reisen in Masse, das Reisen auf Kontrakt, das Gereist-Werden.“ Das Neue, nach dem sich der Reisende sehnt, wird in den populären Reiseführern, auf das Sehenswürdige hin ausgesiebt.
„Es ist nicht mehr der wahre Gott der Wanderer, der Zufall, der die Schritte lenkt“ beklagt der Autor und erinnert an den Gehalt des – aus einer Sicht – authentischen Reisens. „Aber Reise soll Verschwendung sein, Hingabe der Ordnung an den Zufall, des Täglichen an das Außerordentliche, sie muß (…) ureigenste Gestaltung unsere Neigung sein – wir wollen sie darum verteidigen gegen die neue bürokratische, maschinelle Form des Massenwanderung, des Reisebetriebs.“
Auf der letzten Frankreichreise ist uns Stefan Zweig im „Musée Balzac“ begegnet. Seine Biografie über den französischen Schriftsteller ist ein Meisterwerk. Gleiches gilt für seine Erzählung, die dem portugiesischen Seefahrer Magellan gewidmet ist, der mit fünf Kuttern von Sevilla ausfuhr, um in seiner Odyssee die ganze Erde zu umrunden. In der Einleitung begründet Zweig den Ursprung seiner Idee, dieses Buch zu schreiben. Auf der Überfahrt nach Südamerika erlebt der Autor paradiesische Tage. Das Schiff bietet an sich allen Komfort, es herrscht Überfluss und der Alltag an Bord ist perfekt organisiert. Dennoch wird der Reisende ungeduldig und eine gewisse Langeweile schleicht sich ein.
„Erinnere dich, Du Ungeduldiger, erinnere dich, du Ungenügsamer, wie dies vordem war!“ Mit dem Gedanken reagiert der Schriftsteller auf diese Situation. Er wendet sich einem der größten Abenteuer der Menschheitsgeschichte, der Erdumsegelung des Magellan zu. Entbehrung, Tragik und Schicksalsschläge sind die existentiellen Themen, die ihn von seiner Komfortzone ablenken.
„Im Anfang war das Gewürz“ ist der erste Satz seines Buches. Zweig erklärt die ökonomische Motivation der Seefahrer und ihrer Sponsoren. Der Handel mit den Produkten Asiens versprechen den Expeditionen riesige Gewinnaussichten. Magellan, der zehn Jahre für die portugiesische Krone kämpfte, verlässt aus Enttäuschung über mangelnde Anerkennung seine Heimat. Mit seinen neuen spanischen Partnern gelingt es ihm, zu einem der größten Abenteuer der Menschheitsgeschichte aufzubrechen.
Stefan Zweig schildert anhand der historischen Fakten den Verlauf der Reise, die Rebellion der spanischen Mitstreiter gegen den Anführer aus Lissabon, die Abenteuer auf See und den tragischen Fall des Kapitäns nach der Überquerung des Pazifiks. Gleichermaßen faszinierend und plausibel wirken die Schilderungen Zweigs über das Innenleben der Seeleute auf dieser Reise ins Ungewisse. Der Tod, die Gefahr und die Dimension des Schicksals sind stets gegenwärtig und lassen den tief beeindruckten Leser nachdenklich zurück.
Stefan Zweigs Literatur führt uns nach Europa, Indien und Amerika. Reisen, über die er in Feuilletons und Berichten Zeugnis ablegt. Seine eigene Biografie ist von der Flucht vor dem Nationalsozialismus geprägt. Im brasilianischen Exil begeht er 1942 Selbstmord. In seinem Abschiedsbrief hatte Zweig geschrieben, er werde „aus freiem Willen und mit klaren Sinnen“ aus dem Leben scheiden. Die Zerstörung seiner „geistigen Heimat Europa“ war ihm unerträglich, seine Kräfte „durch die langen Jahre heimatlosen Wanderns“ erschöpft.
Literatur:
Stefan Zweig, Magellan, Insel Verlag, 4. Auflage 2020
Stefan Zweig, Auf Reisen, Fischer Taschenbuch, 4. Auflage 2011