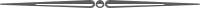Mitten im Berner Oberland liegt das idyllische Meiringen, eingebettet im steilen Haslital und umgeben von beeindruckenden Alpenlandschaften. Berühmt ist der Ort vor allem für die Reichenbachfälle – ein mächtiger Wasserfall, der dramatisch in die Tiefe stürzt. Literarisch berühmt wurde Meiringen durch Arthur Conan Doyle: Hier ließ er in „Das letzte Problem“ Sherlock Holmes in einem epischen Duell mit Professor Moriarty am Rande der tosenden Klippen stürzen. Die abgeschiedene, wilde Umgebung und die spektakuläre Kulisse der Alpen machten Meiringen zum perfekten Schauplatz für Holmes’ dramatisches Finale – und zu einem faszinierenden Ziel für Fans wie auch für Naturliebhaber.
Die steilen Felsen und der mächtige Wasserfall boten eine imposante und symbolträchtige Kulisse für das „letzte Duell“ zwischen Held und Schurke. Doyle suchte einen Ort fernab der Zivilisation, um den Eindruck von Gefahr und Isolation zu verstärken. Die Alpen waren für viele Leser in Großbritannien damals aufregend und fremd, wodurch die Szene noch eindrücklicher wirkte. Wasserfälle und Klippen stehen oft für dramatische Wendepunkte oder das Ende – passend also für die inszenierte „Todesstelle“ von Holmes. Das Städtchen bot die perfekte Mischung aus alpiner Schönheit, dramatischer Wildheit und literarischer Symbolkraft – ideal für das große Finale zwischen Holmes und Moriarty.
Auf psychologischer Ebene sind Sherlock Holmes und Professor James Moriarty weniger Gegenspieler als vielmehr Spiegelbilder derselben geistigen Kraft. Beide sind hochintelligent, analytisch, emotional distanziert und von einer fast übermenschlichen Rationalität getrieben. Doch während Holmes seine Fähigkeiten in den Dienst der Ordnung stellt, nutzt Moriarty dieselben Gaben, um Chaos zu schaffen. In der Sprache der Tiefenpsychologie – insbesondere im Sinne C. G. Jungs – verkörpert Moriarty den Schatten von Holmes: jene verdrängten, dunklen Anteile des Selbst, die der bewusste Geist nicht akzeptieren will. Holmes’ Kampf gegen Moriarty ist also mehr als nur ein Duell zwischen Gut und Böse – es ist ein innerer Konflikt zwischen Vernunft und Versuchung, zwischen Kontrolle und Machtgier, zwischen Licht und Schatten.
In Meiringen findet man heute ein Museum, eine Statue und sogar ein Hotel, das dem berühmten Detektiv gewidmet ist. Die erfundene Figur wird dort beinahe greifbar: Besucher wandern den Pfad hinauf, an dem Holmes gegen seinen Erzfeind Moriarty kämpfte, und legen Blumen an seiner Gedenktafel nieder – als wäre er tatsächlich hier gestorben. Es ist eine faszinierende Umkehrung: Im 19. Jahrhundert wurde eine fiktive Figur – geboren in den Seiten eines Buchs – so real, dass Menschen um sie trauerten. Heute geschieht oft das Gegenteil: Reale Menschen werden virtuell, leben in digitalen Räumen, in Social-Media-Profilen, in KI-generierten Abbildern ihrer selbst.
Sprache und Landschaft prägen das Leben in der Schweiz – überall finden sich Spuren großer Literatur und Treffpunkte der Künstler. Zurück in Zürich, am belebten Bellevueplatz, steht eines der geschichtsträchtigsten Lokale der Stadt: das Café Bar Odeon. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1911 ist das Odeon weit mehr als nur ein Café – es ist ein Stück europäischer Kulturgeschichte im Jugendstil. Zwischen hohen Fenstern, Marmorwänden und messingglänzenden Theken tranken schon Größen wie Albert Einstein, James Joyce, Lenin und die Dadaisten ihren Kaffee. In den 1920er- und 1930er-Jahren wurde das Odeon zum Treffpunkt für Intellektuelle, Künstler, Emigranten und Freigeister aus aller Welt – ein Ort, an dem Ideen so lebendig zirkulierten wie der Espresso.
Besonders faszinierend ist das Gästebuch des Odeon, das von 1917 bis 1932 geführt wurde. Darin verewigten sich viele der berühmten Besucher mit Signaturen, Zeichnungen und Gedanken – ein literarisches und historisches Dokument, das 2017 bei einer Auktion für über 40.000 Franken versteigert wurde. Es erzählt in Tinte, was die Wände des Odeon seit über einem Jahrhundert flüstern: Hier begegneten sich Welten, Ideale und Generationen.
Zürich ist heute eine kosmopolitische Stadt – weltoffen und Ziel vieler Touristen aus aller Welt. Wer durch die Straßen flaniert, hört bald: Hier klingt Deutsch ganz anders. Das Schweizerdeutsch ist kein Akzent, sondern eine ganze Familie lebendiger Dialekte – und es wird mit Stolz gesprochen. Während in vielen Ländern regionale Mundarten vom Hochdeutsch verdrängt wurden, ist das in der Schweiz nie geschehen. Hier gilt: Man schreibt Hochdeutsch, aber man lebt im Dialekt. Der Dialekt ist Identität, Heimatgefühl und ein Stück kulturelle Eigenständigkeit. Gesprochen wird er auch von den vielen Menschen mit Migrationshintergrund, die heute im Land leben. Die lokal eingefärbte Sprache schafft Nähe, Zugehörigkeit – und grenzt freundlich von den deutschen Nachbarn im Norden ab. Ob in der Tram, im Café oder sogar im Radio – Schweizerdeutsch ist überall präsent.
Unser Weg führt schließlich zur Ausstellung „Seelenlandschaften. C. G. Jung und die Entdeckung der Psyche in der Schweiz“ im Landesmuseum – hinein in das Innere eines Landes und in das Innere des Menschen. Zwischen Symbolen, handschriftlichen Aufzeichnungen und Jungs geheimnisvollem Roten Buch entfaltet sich ein Dialog zwischen Wissenschaft und Seele, zwischen Denken und Träumen. „Die Schweiz ist eine Heimat der Seelensucher; ihr psychogeografischer Raum wurde zur Drehscheibe der Psychoanalyse und strahlte weit in die Welt hinaus“, lesen wir im Katalog.
Hier wird sichtbar, wie stark die Landschaft selbst auf diese Psychologie eingewirkt hat: Berge, Seen und Täler erscheinen als Spiegel seelischer Zustände – Orte der Projektion, der Einkehr, des Wandels. Schon Paracelsus, der Arzt und Naturphilosoph des 16. Jahrhunderts, schrieb, dass Natur und Landschaft die Seele formen: Wer den Berg betrachte, erkenne nicht nur Stein, sondern auch das eigene Innere. Diese Idee lebt in Jungs Denken fort – in seiner Überzeugung, dass äußere Welt und innere Psyche untrennbar miteinander verwoben sind. Die Ausstellung macht dies sichtbar: Manuskripte, Gemälde, Fotografien und Klanginstallationen zeichnen seelische Topografien, die so vielfältig sind wie die Schweiz selbst. Zwischen Luzerner Seen, Berner Alpen und Zürcher Ufern spiegelt sich die menschliche Suche nach Bedeutung.
Ein Besuch in „Seelenlandschaften“ ist mehr als ein Museumsrundgang – er ist eine Reise in die geistige Geografie der Schweiz. Man verlässt das Haus nicht unbedingt klüger, aber verbundener – mit der Landschaft, mit sich selbst und mit der stillen Frage, wo die Seele eigentlich wohnt.