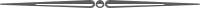Grauer Alltag, graues Wetter. Im Frühjahr zieht es uns in den Süden, in eine farbenfrohe Welt. Dieses Jahr mischen sich ganz andere Grautöne in die gewohnte Aufbruchstimmung. Es herrscht Krieg, nicht irgendwo, in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Das Grauen in der Ukraine lässt sich nicht einfach verdrängen, die Bilder begleiten uns, ob bewusst oder unbewusst. Wir sind schockiert über das Schicksal von Menschen, die nicht reisen dürfen, sondern flüchten müssen. Der Ärger der Reisenden hinsichtlich steigender Dieselpreise, wirkt unter diesem Eindruck, eher wie ein banales Problem.
Es ist kein Zufall, dass Peter Sloterdijk sein neuestes Buch einer ungewöhnlichen Farbenlehre über das Graue widmet. Den Satz Cézannes „Solange man nicht ein Grau gemalt hat, ist man kein Maler“ überträgt der Philosoph in die Welt des Denkens. Sloterdijk erinnert an die Phänomene der Finsternis, des Nebels, der Stürme und beschreibt die Strudel der Zweifel, die Erfahrungen der Gottesferne, die Trostlosigkeit des Nihilismus, also die Abgründe, die viele Schriftsteller und Denker zeitlebens beschäftigten. Seine Abhandlung schließt mit dem Satz: „wer noch kein Grau gedacht hat, dem ist die Frage unde bonum, Woher das Gute?, die das Herz der Seinsfrage bildet, noch nicht begegnet.“ Der bewusste Umgang mit dem Grauen, mit den Grauzonen dieser Erde, die wir immer und überall finden, bereitet die intensive Erfahrung anderer Farben des Spektrums vor.
Goethe schrieb in seiner berühmten Farbenlehre den Farbtönen übergeordnete Eigenschaften zu: Blau etwa verband er mit Verstand, Gelb mit Vernunft, Grün mit Sinnlichkeit und Rot mit Phantasie. Die Anwendung von Farben zählt nicht nur zu den ältesten Formen der Heilbehandlung, die Sehnsucht nach der Hochzeit des Lichts, erklärt letztlich unsere Reiselust.
Natürlich begegnet uns auf jeder Reise das Graue, sogar auf dem Weg in den Süden. Es spiegelt sich im Asphalt der Straßen, in den Betonsilos der Vorstädte oder in der Eintönigkeit der Einkaufszentren. Wir ignorieren gerne diese Aspekte auf dem Weg zu den Stränden, Bergen und Sehenswürdigkeiten. Nur selten nehmen wir unterwegs Friedhöfe, Krankenhäuser oder Arbeitsämter wahr, obwohl wir an diesen Orten wohl am besten verstehen würden, wie das Leben der Menschen in anderen Räumen wirklich ist.
Die Grautöne, ob wir wollen oder nicht, greifen in unsere Stimmungen ein. „Ein heiterer Tag ist wie ein grauer, wenn wir ihn ungerührt ansehen“ liest man in Goethes Wilhelm Meister über den fortlaufend drohenden Verlust der Sinnlichkeit. „Die Wüste wächst, weh dem der Wüsten birgt“ heißt es bei Nietzsche. Der Umkehrschluss, der sich aus dem Lehrsatz Goethes ergibt, gilt: Wir sind in der Lage, mit unserer inneren Kraft, graue Tagen zu wenden und in ihnen Helligkeit abgewinnen. Wer sich auf Grautöne einlässt, statt sie zu verdrängen, steht schon in der Erwartung, in der Offenheit, für die Ankunft anderer, ergänzender Farben aus dem Spektrum.
„Die Welt ist wunderbar im Ganzen“ kommentierte einst der Schriftsteller Ernst Jünger unsere Lage. Er beschrieb so einen Zustand, der versucht, unbeeindruckt von den Katastrophen und Abgründen, positiv zu bleiben. „Das Licht und die Finsternis stellen gleichursprüngliche Prinzipien dar, die wie Könige benachbarter Reiche miteinander im Streit liegen“ schreibt Sloterdijk.
Dürfen wir reisen in diesen Zeiten? Nun, so wie man noch am letztem Tag der Welt ein Baum pflanzt, so bricht man immer wieder auf.
Literatur: Peter Sloterdijk, Wer noch kein Grau gedacht, Suhrkamp Verlag 2022