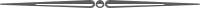In der Berliner Nationalgalerie hängt ein Gemälde, das uns beschäftigt. „Der Mönch am Meer“ stammt von dem Maler Caspar David Friedrich (1774-1840). Zur Vorbereitung des 250. Geburtstages des Künstlers, den wir in Deutschland nächstes Jahr feiern, lesen wir ein wenig über die Hintergründe des Künstlers. Die Beiträge betonen die Bedeutung des Jahrhundertmalers und erklären die oft rätselhaften Werke, wie zum Beispiel den „Wanderer über dem Nebelmeer“. Was macht den Maler bis heute so faszinierend?
Vermutlich ist es die eigentümliche Stimmung seiner Bilder, die uns begeistern und mit dem Zeitgeist korrespondiert. In einer Welt, in der der „entzauberte“ Blick auf die Umwelt dank der Technik immer dominanter wird, schreibt der Kunsttheoretiker Laszlo Földenyi, kommt die krampfhafte Sehnsucht nach Selbstvergessenheit in der Natur einer Art metaphysischen Selbstrost gleich.
Der Maler ist ein Vertreter der Romantik. Eigentlich ist das Denken in Deutschland seit Immanuel Kant auf eine Vernunft bezogen, die über der Sinnlichkeit steht, sozusagen wie ein Herrscher über das Volk. Nur, an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, beschreibt Florian Illies in seinem Bestseller „Zauber der Stille“, erscheint vielen die Natur zur Anbetung Gottes besser geeignet wie ein Kirchengebäude. In der Romantik stehen Naturempfindung und emotionale Religiosität im Mittelpunkt. Die Pendants Religion und Natur erscheinen nicht in Form von Gegensätzen, sondern, wie es Friedrichs Ikonografie entspricht als zwei sich bedingende Tugenden: Glaube und Hoffnung. Die Welt wird zur Projektion des Inneren. Der Bildhauer Pierre D`Angers sieht in dem Maler den Mann, „der die Tragödie der Landschaft entdeckt hat“.
Das Bild „Mönch am Meer“ ist in den Jahren zwischen 1808-10 entstanden. Der Kunsthistoriker Werner Busch sieht in dem Werk das Altarbild des modernen Menschen. Friedrich Biograf Boris von Brauchitsch erkennt im Mönch, „die zukunftsgerichtete Spiritualität, die nur der Gewalten der Natur bedarf, um jederzeit und an jedem Ort unter freiem Himmel ihren Gottesdienst zelebrieren zu können.“
Jeden Monat versuchen tausende Besucher die Botschaft des Bildes zu enträtseln. Manche vermuten einen protestantischen Geistlichen, der mit Demut das irdische Dunkel erträgt und auf das Jenseits hofft, andere erkennen die Erhabenheit des Menschen gegenüber den Mächten der Natur. Nicht wenige erfahren in ihrer Betrachtung Entfremdung und Einsamkeit, den Nihilismus einer von Transzendenz verlassenen Welt. „Nie zuvor ist der Zweifel an Gott, die Nichtigkeit des Einzelnen und seine Verlorenheit angesichts der Urkräfte der Natur kompromissloser dargestellt worden“ schreibt Florian Illies über diese Art der Interpretation. Einig dürften sich alle Besucher der Nationalgalerie nur über die Faszination der Atmosphäre sein, die die Gemälde entstehen lassen und jeden Zuschauer einbezieht. Der Philosoph Peter Sloterdijk weist auf die Einmaligkeit dieser Kunst hin, denn „es ist das erste Bild der Auflösung des Subjekts in der Substanz.“
Wie immer wir heute den Mönch am Meer sehen, für den Maler selbst erklärte sich sein Schaffen aus dem Glauben. Friedrich schrieb über sein Kunstwerk: „Und sännest Du auch von Morgen bis Abend bis zur sinkenden Mitternacht; dennoch würdest du nicht ersinnen, nicht gründen das unerforschliche Jenseits.“ Florian Illies streicht die religiöse Grundüberzeugung des Künstlers heraus: „Friedrich liebte die Sterne, die Planeten und den Mond. Ja, er verehrte diese himmlischen Regenten. Er glaubte aber jedoch nicht an deren Macht, sondern nur an die Gottes.“
Zwei berühmte Männer der deutschen Geistesgeschichte sahen das Bild im Atelier des Malers in Dresden: Friedrich Schleiermacher (1768-1834) und Johann Wolfgang von Goethe. Der Religionsphilosoph war am 12. September 1810 bei Friedrich, sechs Tage vor dem Dichter. Werner Busch berichtet, dass der Künstler das Bild nach dem ersten Besuch übermalte, vereinfachte und weiter abstrahiert hatte. Der Einfluss Schleiermachers auf das religiöse Verständnis des Malers ist offensichtlich. Er sah in der Glaubenswelt den Ausdruck des Gefühls der „absoluten Abhängigkeit“ von etwas Größerem und Transzendentem. Die Subjekt-Objekt-Spaltung zwischen Wahrnehmendem und Wahrgenommenem überwindet, so behauptet der Philosoph, der Glaube. „Die Religion begehrt nicht, das Universum seiner Natur nach zu erklären, wie die Metaphysik, sie begehrt nicht, den Menschen fortzubilden und besser zu machen wie die Moral. Ihr Wesen ist weder Denken noch Handeln.“ In seiner Erkenntnistheorie ist eine Teilhabe am Göttlichen, nicht erst in einem Jenseits nach dem Tod möglich.
Goethe lobte Schleiermacher zunächst wegen seiner Bildung, doch, wie er Schiller gestand, verlor er die Lust an dieser Lehre, weil sie ihm zu christlich war. Gegenüber der Romantik, in der er das Überspannte, Diffuse und Kranke ausmachtet, blieb er zeitlebens reserviert. Obwohl der Dichter keineswegs zur Gruppe der rationalistischen Naturwissenschaftler zählte, erinnert Laszlo Földenyi, enthielt er sich des Naturkults. Goethe liebte die Ordnung, Harmonie und Schönheit, die nach seiner Meinung allein in der antiken Kunst zu finden waren. Die Romantiker hingegen bevorzugten oft das Irrationale, das Emotionale und das Unordentliche. Goethe lehnte diese Abkehr von den klassischen Prinzipien ab. Während Friedrich immer ein Mann des Nordens blieb, flüchtete der Dichter, einem Burnout nahe, „vom gleichgültigen Nebelmeer der öffentlichen Geschäfte“ (von Arnim) Richtung Italien. Obwohl er nur ein mäßig begabter Maler war, entwickelte er im Land der Zitronen seinen Kunstbegriff, folgte den Regeln einer altertümlichen Ästhetik und suchte in Rom nach der Antike.
Bei einem Besuch bei Friedrich 1810 in Dresden beschäftigte ihn der Mönch am Meer und reagiert ambivalent. Vermutlich, so Illies, wollte er „seine eigene gefährdetet Seele fast panisch von diesen schwermütigen Tönen freihalten.“ Das Verhältnis des Dichters zum Maler war schwierig. „Die Bilder von Friedrich könnten ebenso auf dem Kopf gesehen werden“ polemisierte er und kritisierte die „düsteren Religionsallegorien“. Goethe misstraute der Subjektivität menschlicher Wahrnehmung und betonte – ganz Wissenschaftler – beispielsweise die Objektivität des Lichts. In einem Disput mit Schopenhauer rief er: „Das Licht soll nur da sein, insofern sie es sehen? Nein, Sie wären nicht da, wenn das Licht Sie nicht sähe.“
Goethe traf Friedrich erneut im Herbst 1816, um ihn zu bitten, die von dem Meteorologen Howard beschriebenen Wolkentypen zu malen. Der Künstler, der den Nebel für genauso untrennbar mit dem Betrachter, mit seinem augenblicklichen Zustand, verbunden hielt wie Schopenhauer das Licht, lehnte schroff ab. Von Brauchitsch erklärt die Ablehnung damit, dass er befürchtete, durch eine Kategorisierung und Klassifizierung von Wolken, wie sie Goethe voranzutreiben gedachte, eine Entzauberung der Landschaftsmalerei zu betreiben.
Der Mensch in den Bildern Friedrichs, stellt Werner Busch in seiner Abhandlung klar, geht nicht in der Natur pantheistisch auf und erfährt keine in Kants Sinne eigene Erhabenheit angesichts der Natur. Sondern, so Busch, er wird sich im Gegenteil im Licht der Umwelt seiner Nichtigkeit bewusst und hofft in staunender Anschauung von Gottes Schöpfung auf die Erlösung. „Die Selbstbehauptung, im Sinne von Kants Definition des Erhabenen als verstandesmäßige Bewältigung des Übermächtigen, wäre nach Friedrich nur Faustische Selbstüberhebung“.
Literatur:
Florian Illies, Zauber der Stille, S. Fischer Verlag, Frankfurt 2023
Laszlo Földenyi, Der Maler und der Wanderer, Mathes & Seitz Verlag, Berlin 2021
Boris von Brauchitsch, Caspar David Friedrich, Insel Verlag, Berlin 2023