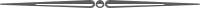Göhren liegt an der südöstlichen Spitze Rügens, eingebettet in die sanfte Hügellandschaft der Halbinsel Mönchgut. Das Ostseebad besticht durch seine besondere Lage zwischen zwei Stränden – dem feinsandigen Nordstrand mit Seebrücke und dem ruhigen, naturbelassenen Südstrand. Zwischen Steilküste, Buchenwäldern und Reetdachhäusern entfaltet sich eine Atmosphäre, die gleichzeitig maritim, ländlich und fast ein wenig zeitlos wirkt. Die weiten Ausblicke über die Ostsee, die frische Brise und das Licht der Insel verleihen der Gemeinde eine ruhige, fast poetische Stimmung – ideal, wie wir finden, für alle, die Natur, Geschichte und Erholung miteinander verbinden möchten. Wer heute durch den Ort schlendert, kann spüren, warum Künstler hier Ruhe und Kreativität fanden.
Am Museumshof – mitten im Ort – steht nicht nur das liebevoll restaurierte, reetgedeckte Haus, sondern auch ein Foto eines Dachdeckers, der das Gebäude ehrenamtlich neu mit Reet gedeckt hat. Daneben ein schlichtes, aber eindrucksvolles Zitat von ihm: „Ich wünsche, dass meine Heimat, meine Heimat bleibt.“ Dieser Satz, so einfach er klingt, bringt das auf den Punkt, was wir vielerorts ihier spüren: das Spannungsfeld zwischen touristischer Entwicklung und dem Bedürfnis nach Bewahrung von Heimat und Identität. Auf der einen Seite moderne Hotels, touristische Infrastruktur und Besucherströme – auf der anderen Seite Menschen, die sich aktiv dafür einsetzen, dass Orte mit Seele nicht verloren gehen.
Ein paar Schritte weiter besuchen wir das Heimatmuseum, wo aktuell die Ausstellung „Sonne, Strand und Sozialismus“ zu sehen ist. Eine engagierte Arbeitsgruppe aus dem Ort hat diese Schau mit viel Liebe zum Detail vorbereitet – und sie ist unbedingt einen Abstecher wert. Die Ausstellung widmet sich dem Urlaub in der DDR, speziell an der Ostseeküste, und beleuchtet die Urlaubsrealität zwischen FDGB-Ferienheim, Zeltplatz und Interhotel. Viele Originalfotos, Dokumente und Exponate vermitteln ein lebendiges Bild dieser Zeit. Besonders schön fanden wir die Möglichkeit für Besucher, eigene Urlaubserinnerungen aufzuschreiben und an eine Pinnwand zu heften. So entsteht ein ganz persönliches Bild davon, was „Erholung“ früher bedeutete – aus Sicht derer, die sie erlebt haben.
Das Museum ist ein Ort der Erinnerung, der Begegnung – und auch des Nachdenkens darüber, wie sich Tourismus, Lebensgefühl und Gesellschaft im Laufe der Zeit verändert haben.
In der DDR war Urlaub kein Luxus, sondern ein Grundrecht: Seit 1949 war das Recht auf Erholung fest in der Verfassung verankert. Der Staat sah es als seine Aufgabe, allen Werktätigen regelmäßige Erholung zu ermöglichen – allerdings zu sozialistischen Bedingungen. „Jeder Werktätige hat das Recht auf einen erholsamen Urlaub – organisiert, sozialistisch, solidarisch“, las man in den 1980er Jahren im FDGB-Urlaubskatalog.
In den frühen Jahren – bis etwa 1953 – waren noch viele Hotels, Pensionen und Ferienunterkünfte privat geführt, gerade in traditionellen Kurorten und an der Ostsee. Doch das änderte sich schlagartig mit der sogenannten „Aktion Rose“: Im Februar 1953 wurden an der Ostseeküste hunderte private Hotels und Pensionen enteignet, viele Betreiber verhaftet oder zur Flucht gedrängt – ein drastischer Schritt zur Verstaatlichung des Tourismus. Ab diesem Zeitpunkt übernahm der Staat die Kontrolle über nahezu alle touristischen Einrichtungen. Da Auslandsreisen für die meisten Menschen tabu waren, boomte der Binnentourismus – organisiert und gelenkt durch staatliche Institutionen. Besonders beliebt war die Ostseeküste.
Unterkünfte in den heiß begehrten FDGB-Ferienheimen wurden zentral vergeben, größtenteils über den Betrieb oder die Gewerkschaft. Wer Glück hatte, ergatterte einen Platz im Ferienheim oder Bungalowdorf – wer nicht, wich auf Camping aus. Dafür gab es in der DDR über 500 staatlich betriebene Campingplätze – exakt 531 im Jahr 1989, die mehr als 2,5 Millionen Feriengäste zählten.
Die Plätze waren eher einfach ausgestattet, aber erschwinglich – und gerade bei Familien sehr beliebt.
Erholung bedeutete in der DDR nicht nur Entspannung, sondern auch Gemeinschaft, Bildung und Ideologie: Kulturveranstaltungen, politische Vorträge und Gruppenreisen gehörten oft dazu.
Trotz aller Einschränkungen bleibt – so lesen wir auf der Pinnwand im Museum – bis heute ein Gefühl von Nostalgie: Urlaub in der DDR – einfach, organisiert, aber für viele doch ein echtes Stück Freiheit im Alltag.
In einem Café recherchieren wir weiter über die Geschichte des sogenannten „Dübener Ei“. Der kugelige Leichtbauwohnwagen zählt zu den ältesten und bekanntesten Wohnanhängern Deutschlands.
Seine Geschichte begann bereits 1936 im sächsischen Bad Düben, wo der Ingenieur Max Würdig das markante, eiförmige Fahrzeug konstruierte – aus einem sehr persönlichen Grund: Auf einer Reise mit seiner Freundin verweigerte man ihnen als unverheiratetem Paar die Unterkunft in einem Gasthaus. Aus dieser Erfahrung entstand die Idee, eine mobile, unabhängige Schlafmöglichkeit zu bauen – das erste „Dübener Ei“ war geboren. Die DDR setzte die Produktion des Würdig 301 (später: 301-2) fort, meist in Handarbeit und unter erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen. Dennoch blieb das Fahrzeug beliebt – für viele war es ein Symbol von Freiheit auf zwei Rädern. Zeitgleich im Westen entwickelte Arist Dethleffs – wie wir an anderer Stelle erzählen – seinen eigenen Wohnwagen, ursprünglich als „Wohnauto“ für seine Frau, eine Künstlerin, gedacht. Während aus dieser Idee eine erfolgreiche Wohnwagenindustrie entstand, blieb Würdigs Erfindung ein Stück ostdeutscher Ingenieurskunst im Kleinen. Ost und West – erstaunlich, wie unterschiedlich manche Lebensläufe verliefen.
Wir schlendern weiter durch Göhren. Nach der Wiedervereinigung 1990 erlebte die Ostseeinsel Rügen einen beispiellosen Tourismusboom. Jahrzehntelang war die Region vor allem Urlaubsort für DDR-Bürger – doch nun rückte sie plötzlich in den Fokus westdeutscher Investoren, Bauherren und Ferienhausanbieter. Das einst beschauliche Seebad Göhren stand stellvertretend für viele Orte im Osten vor einem Dilemma: Wie lässt sich die eigene Identität bewahren – und gleichzeitig touristisch attraktiv werden? Die Entwicklung verlief nicht konfliktfrei. Ein Großinvestor prägte zunehmend die Gemeindeentwicklung, zahlreiche Ferienanlagen entstanden, Flächen wurden touristisch umgewidmet. Der Ort wandelte sich – baulich, sozial und kulturell. Die Debatte um diese „Metamorphose“ schlug hohe Wellen: Der Dokumentarfilm Wem gehört mein Dorf? (veröffentlicht 2019) zeichnete die Auseinandersetzungen in Göhren nach – zwischen Alteingesessenen, Rückkehrern, Investoren und Lokalpolitik.
Uns gefällt, inspiriert diese Gemeinde im Mönchgut. Die Geschichte Rügens nach der Wende zeigt: Tourismus bringt Chancen – aber auch Verantwortung. Man wandert durch ein Spannungsfeld: Nicht selten prallen dabei Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf engem Raum zusammen.