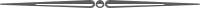Sind Reisende die letzten Romantiker? Wir suchen oft nach einer „reinen“ Schönheit, die nicht von der industriellen und urbanen Moderne entstellt wurde. Viele Touristen sind auf der Suche nach Orten, die als „unberührt“ gelten. Den Tourismus kann man als eine Form der Flucht in eine idealisierte Welt der Schönheit interpretieren. Die realen, komplexen sozialen, politischen oder ökologischen Probleme vieler Reiseziele bleiben oft unberücksichtigt, was zu einer Art des oberflächlichen Sehens führen kann, das die tiefere Realität ausblendet.
Walburga Hülk stellt uns in ihrer neuen Biografie über Victor Hugo nicht nur einen Jahrhundertmenschen, sondern auch einen Reisenden vor. Der Schriftsteller war im 19. Jahrhundert viel unterwegs und reiste aus verschiedenen Gründen, sei es, um seine politischen Exilaufenthalte zu erreichen oder aus künstlerischem Interesse. In seinem Werk spricht Hugo oft von Reisen als eine Art der Erlangung von Wissen und Erleuchtung. Nach seiner politischen Verurteilung und dem Exil 1851, verbrachte er viele Jahre in Jersey und Guernsey, kleinen Inseln im Ärmelkanal. Diese Reisen und der Aufenthalt im Exil hatten einen prägenden Einfluss auf sein Leben und seine Werke.
In seinem berühmten Roman „Les Misérables“ (Die Elenden) wird das Schicksal des Protagonisten Jean Valjean, von einer physisch-moralischen Flucht hin zu einer spirituellen und sozialen Erlösung, dargestellt. Hier wird das Reisen nicht nur als Bewegung durch geographische Räume verstanden, sondern als ein symbolischer Weg. Die Figuren erleben auf ihrem Weg eine soziale und politische Metamorphose.
Gerechtigkeit ist das Motto dieses monumentalen und wirkmächtigen Romans, der bis heute eine unvergleichliche Strahlkraft ausübt. „Es geschah“, beschreibt Walburga Hülk „im Rahmen der Möglichkeiten des 19. Jahrhunderts, etwas Staunenswertes: Les Miserables ging viral.“ Seine Schilderungen über das Entstehen von monströser Armut und monströsen Reichtum schlug wie eine Bombe ein und bewegte sein Publikum in der ganzen Welt.
Geschildert wird die französische Gesellschaft von der Zeit Napoleons bis zu der des Bürgerkönigs Louis Philippe. Im Mittelpunkt steht der ehemalige Sträfling Jean Valjean. Nach 19 Jahren Haft, die er für den Diebstahl eines Stücks Brot durch Einbruch, sowie für vier Fluchtversuche erhalten hat, ist er ein von der Gesellschaft gebrandmarkter und innerlich verhärteter Mensch. Durch seine Begegnung mit dem Bischof von Digne, einem sehr gutherzigen Seelsorger, der ihn Güte erfahren lässt, bekehrt er sich und wird zu einem moralisch guten Menschen.
In Victor Hugos berühmtem Werk kommt der Sozialismus zwar nicht explizit als eine politische Ideologie vor, aber er thematisiert auf sehr eindrucksvolle Weise die sozialen Missstände und die Ungleichheit, die das Leben der Armen und Unterdrückten prägen. Im Gegensatz zu dem in seiner Zeit verbreiteten Materialismus, bekannte Hugo sich ausdrücklich zu dem Glauben an eine höhere Instanz. Die metaphysische Haltung des Schriftstellers beschreibt Walburga Hülk wie folgt:
„Kritik an allen herrschen Religionen wegen Machtmissbrauch der Kleriker, doch Toleranz gegenüber allen Religionen oder vielmehr die Überzeugung, sie alle zerstören zu müssen, um Gott im Menschen neu zu schaffen.“
Es gibt zahlreiche moderne Autoren und Philosophen, die sich auf Victor Hugos „Les Misérables“ beziehen oder dessen Ideen in ihren eigenen Werken aufgreifen. Der Roman hat bis heute einen großen Einfluss auf die Literatur und soziale Philosophie. Der französische Existentialist und Philosoph Jean-Paul Sartre war stark von den sozialen und moralischen Fragen dieses Werkes beeinflusst. In seinem Denken betont Sartre die Verantwortung des Individuums, seine Freiheit zu nutzen, um eine bessere Gesellschaft zu schaffen. Hugo schildert ähnliche moralische Dilemmata, wie sie in der Existenzphilosophie vorkommen: Wie kann der Einzelne im Angesicht von Ungerechtigkeit und Unterdrückung richtig handeln?
Der französische Sozialtheoretiker und Philosoph Michel Foucault beschäftigte sich mit den Machtstrukturen, Strafsystemen und sozialen Institutionen, die in „Les Misérables“ eine große Rolle spielen. Insbesondere die Darstellung des Justizsystems und der Umgang mit Verbrechern, etwa der Charakter von Jean Valjean, lesen sich im Kontext von Foucaults Werk Überwachen und Strafen (1975) als eine Fallstudie für die kritische Betrachtung moderner Strafsysteme und problematisieren die Entstehung von Macht durch Institutionen. Foucault stellt damit die Antithese zu der romantischen Sehnsucht des Tourismus auf: Die Wahrheit einer Gesellschaft findet sich aus seiner Sicht an ihren Rändern. Ob wir diese Wirklichkeit sehen wollen, entscheidet jeder Reisende für sich.
Hugos Modernität zeigt sich in seinem Umgang mit dem „Mythos Paris“. Touristische Sehenswürdigkeiten der Stadt der Liebe spielen in dem Roman nur eine Nebenrolle. Die Metropole ist eine Weltbühne, Schauplatz von Transformationen, deren Bedeutungen sich nicht auf Frankreich beschränken. 1867 beschreibt er seine politische Vision der Grenzenlosigkeit: „Diese Nation wird Paris als Hauptstadt haben, doch wird sie nicht mehr Frankreich heißen, ihr Name wird Europa sein.“
Die Kathedrale Notre-Dame ist in den „Les Miserables“ kein geistiges Zentrum mehr wie im Mittelalter. Es fehlt in der Moderne, in einer Epoche der politischen und technologischen Revolutionen, an zentralen Orientierungspunkten.Hugo beschreibt bewusst nicht nur die äußerlichen Schönheiten der Stadt. Unter den prächtigen Gebäuden und Straßen entdeckt er ein unsichtbares Labyrinth: Die Kanalisation der Großstadt. Der Schriftsteller bezieht diese Orte in die Handlung des Romans ein. Das moderne Paris, das er meisterhaft beschreibt, ist dezentriert, halt- und formlos, es wuchert in den Randbezirken der Banlieus, driftet in die Peripherie. Hugos Blick richtet sich auf diese Grenzbereiche:
„Die Welt der Vorstädte zu beobachten heißt, eine Amphibienwelt zu beobachten. Ende der Bäume, Beginn der Dächer, Ende des Grases, Beginn des Pflasters, Ende der Ackerfurchen, Beginn der Läden, Ende der Wagenspuren, Beginn der Leidenschaften, Ende des Murmelns der Gottheit, Beginn des menschlichen Lärms, von daher ein außerordentliches Interesse.“
Und heute? Nach wie vor besuchen Millionen Touristen jedes Jahr die französische Hauptstadt, bewundern den Eifelturm, entdecken die Museen und flanieren auf den Prachtstraßen. Das Leben in den Vorstädten erweckt kaum das Interesse der Besucher. Die Probleme in den sozialen Brennpunkten, Stadtviertel wie Montfermeil, sind nicht die gleichen wie 1862, aber angesichts der heftigen Tumulte der letzten Jahre, nicht weniger beunruhigend.
In der Tradition von Hugo zeigt Ladj Lys das Paris der „Elenden“ in einem faszinierenden Film. Im Jahr 2018 ist Frankreich gerade Fußballweltmeister geworden und alle Franzosen, auch die mit Migrationshintergrund, sind bei den Feierlichkeiten am Eifelturm vereint. Dann führt die Kamera uns langsam in den Alltag rund um die Wohnmaschinen der Vorstädte, die von Perspektivlosigkeit und Armut geprägt sind. Es tauchen Charaktere auf, Jugendliche, Religiöse, Polizisten und Kriminelle, die wie Romanfiguren wirken. Die staatlichen Programme versuchen ein fragiles Gleichgewicht zu bewahren. Es fehlt an Bildung und Kultur.
Im Abspann wird Victor Hugo zitiert: „Meine Freunde, behaltet dies im Gedächtnis. Es gibt weder Unkraut noch schlechte Menschen. Es gibt nur schlechte Ackerbauern.“
Literatur:
Karlheinz Stierle, Der Mythos von Paris, Suhrkamp Verlag, Berlin 2021
Walburga Hülk, Victor Hugo, Jahrhundertmensch, Mathes & Seitz, Berlin 2025