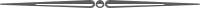Von außen betrachtet leben wir in einem Zeitalter größtmöglicher Freiheit. Nie war die Welt so offen, so erreichbar, so bereitgestellt. Auf den Bildschirmen flimmern Landschaften wie leuchtende Verheißungen: das Türkis der Südsee, das Nebelgrau Islands, die roten Felsen Jordaniens. Ein paar Klicks – und der Traum wird zur Buchung. Die Welt scheint uns zu gehören. Doch je größer die Auswahl, hat man den Eindruck, desto unerreichbarer wird die eigentliche Erfahrung des Reisens. Wir können überallhin reisen, doch oft kommen wir nirgends wirklich an. Hinter dem Glanz der Wahlmöglichkeiten öffnet sich ein merkwürdiger Mangel: Die Welt antwortet nicht mehr.
Der Philosoph Slavoj Žižek hat diese paradoxe Freiheit beschrieben. In der digitalen Moderne, sagt er, werden wir unaufhörlich aufgefordert zu wählen – zwischen A und B, zwischen Like und Dislike, zwischen Bali und Barcelona. Die Freiheit der Wahl ist selbst zur Form der Kontrolle geworden. Sie erzeugt erst das Begehren, dem wir folgen sollen. Wir klicken, um zu begehren, und begehren, um zu klicken. Auch das Reisen folgt diesem Mechanismus. Plattformen, Empfehlungen, Bewertungen – sie alle versprechen Authentizität, während sie uns zugleich von ihr entfernen. Wir reisen in kuratierten Routinen, fotografieren, posten, vergleichen. Jeder Ort wird Kulisse, jedes Erlebnis eine Vorlage für ein nächstes.
Hier setzt die Resonanztheorie des Soziologen Hartmut Rosa an. Für Rosa bedeutet ein gelingendes Leben nicht, möglichst viel zu erleben, sondern in Beziehung zu treten – mit Menschen, Dingen, Orten, Klängen und Gedanken. Resonanz, sagt er, entsteht dort, wo die Welt uns berührt, und wir antworten.
„Im Blick auf eine Theorie der Weltbeziehung, beschreibt Resonanz sodann einen Modus des In-der-Welt-Seins, das heißt eine spezifische Art und Weise des In-Beziehung-Tretens zwischen Subjekt und Welt“.
Doch diese Resonanz lässt sich nicht, wie uns viele Dienstleister in der Reisewelt suggerieren, herstellen. Sie entzieht sich der Logik der Verfügbarkeit. Rosa spricht von ihrer Unverfügbarkeit – jener Dimension des Lebens, die sich nicht planen, nicht konsumieren und nicht absichern lässt. Die modernen Strategien der Beschleunigung und Effizienz zerstören genau jene stillen Räume, in denen Resonanz wachsen könnte. Und so verstummt die Welt.
Die Theorie erklärt uns, warum selbst der schönste Strand, das vollkommene Licht, die fernste Reise nicht notwendig in einen Resonanzraum führt und manchmal leer bleibt. Oder, warum uns oft wenig spektakuläre Orte, die wir eher zufällig besucht haben, länger in Erinnerung bleiben. Wenn wir auf unsere Reisen zurückblicken, stellen wir fest, dass Resonanz meist unerwartet geschieht. Sie stellt sich ein, wenn man sich verfährt, seinen Plan ändert oder spontan eine Pause macht. In solchen Momenten antwortet die Welt. Etwas berührt uns – und wir sind nicht mehr dieselben. Das Ziel ist nicht der Ort, sondern die Begegnung – mit der Welt, mit dem anderen, mit uns selbst. Die Freiheit, überallhin zu können, ist bedeutungslos, wenn die Welt stumm bleibt. Und vielleicht ist das größte Abenteuer unserer Zeit nicht mehr das Reisen selbst, sondern das Wieder-Hören-Lernen – auf das Rauschen der Bäume, das Lachen eines Fremden, den eigenen Herzschlag. Dann, für einen Augenblick, öffnet sich eine Welt und wir erleben den Zauber des Reisens.
Literatur:
Hartmut Rosa, Resonanz, Eine Soziologie der Weltbeziehung, Suhrkamp Verlag, Berlin 2019