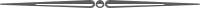Warum fasziniert uns Griechenland? Die Antwort ist denkbar einfach: Weil es schön ist. Wir erinnern uns an das blaue Meer, die Inseln, die Strände, die Berge und an die sagenhaften Farben, in die die Landschaft eingetaucht ist. Dieses Licht – so schreibt der englische Reiseschriftsteller Leigh Fermor, beherrscht „Zaubertricks“. Die Luft wirkt wie eine Linse. „Das Auge sendet einen teleskopischen Tastfinger aus und liest damit die Details und Textur einer Kirche, eines Waldes oder einer Schlucht in zehn Meilen Entfernung, als seien sie in Blindenschrift geschrieben.“ Fermor setzt begeistert über das Spiel von Farben, Licht und Schatten fort: „Diese Eigenheiten haben eine seltsame Wirkung auf die griechische Landschaft. Die Natur wird übernatürlich; die Grenzen zwischen dem Physischen und Metaphysischen verschwimmt“.
Damit verknüpft Fermor die Faszination des Landes von Homer, Platon und Aristoteles – mit den alten philosophischen und erkenntnistheoretischen Fragen des Menschen. In Griechenland sonnt man sich nicht nur. Wir hoffen seit jeher durch den Besuch der antiken Stätten, auf eine Nähe zu einer Welt, die göttlichen Eingebungen verspricht, oder, wenn man es anders sagen will, auf die Möglichkeit eines höheren Bewusstseins. Fest steht, die Begegnung mit der Natur, der Kunst und den Menschen dieses Teils Europas begeistert Millionen von Besucher jedes Jahr.
Das Bestreben im antiken Griechenland einen Orientierungspunkt für das eigene Dasein zu entdecken hat in Deutschland eine lange Tradition. Der Begründer der klassischen Archäologie und modernen Kunstwissenschaften – Johann Winckelmann – war der Held einer ganzen Generation von Schriftstellern und Dichtern: Goethe, Schiller, Hölderlin. Der Gelehrte aus Stendal erhob das Betrachten von Kunstwerken, dargeboten mit literarischen Mitteln, in einen Rang, den zuvor nur die Beschäftigung mit der antiken Literatur innehatte. Die Idee, die griechischen Ideale, von der Schönheit bis zur Tugend nachzuahmen, prägte die Weimarer Klassik. Paradoxerweise hat keiner der großen Männer das Land selbst je betreten.
Der Philosoph Rüdiger Safranski erklärt in seiner Hölderlin-Biografie eine wesentliche Dimension der klassischen Griechenlandsehnsucht: „Es ist Schillers origineller Gedanke, dass womöglich ein Zusammenhang besteht zwischen christlichen Monotheismus und der Herrschaft der abstrakten Vernunft in der Moderne. Der christliche Monotheismus hat Gott in ein unsichtbares Jenseits und in eine ebenso unsichtbare Innerlichkeit versetzt und hat die Welt damit erkalten lassen.“
Der Entzauberung der Verhältnisse entzieht sich Schiller mit seinem, der Antike entliehenen, Kunstbegriff. Sein Programm sah vor, dass der Mensch sich ästhetisch bilden müsse, um von Schönheit ergriffen und zur Freiheit ermuntert zu werden.
Der Ansatz Friedrich Hölderlins, ein Bewunderer Schillers, klingt noch radikaler: Er nahm die antike Götterwelt im religiösen Sinn ernst. Sein Traum von einem anderen Anfang, in dem eine Rückkehr der Götter erfahrbar wird, prägte seine Dichtung. „Eines zu sein mit Allem, was lebt, in seliger Selbstvergessenheit wiederzukehren ins All der Natur“ liest man in seinem Briefroman Hyperion über den erträumten Zustand. Die griechische Mythologie wird in seinen Gedichten zum Vorbild einer zukünftigen, schöneren Welt, die die verlorene Einheit wiedergewinnt.
Hölderlin löste in seiner Zeit einen Streit zwischen Dichtern und Philosophen aus. Man warf nicht nur ihm vor, dass sein Griechenlandbild der Einbildung entsprang und eine Fata Morgana sei. Die „schönen Künste“ – auf die sich die Weimarer Klassik als vereinendes Element bezieht, wurden in den nachfolgenden Jahrhunderten fragwürdig. „Im Supermarkt der Künste findet jeder was ihm gefällt, zur Einheit fügt sich nichts mehr“ schreibt Karl-Heinz Ott über die Entwicklung der modernen Kunstlandschaft. Der Anspruch einer Kunst, die die Flucht der Götter zu überwinden versucht, wird heute belächelt.
Zur Faszination Griechenland gehört das Anliegen, mehr über die realen Lebensverhältnisse dieser Zeit herauszufinden. Die Quellenlage ist unübersichtlich. Was sind glaubwürdige Erinnerungen, wo handelt es sich um Spekulation und Verklärung? Eine neue Möglichkeit bieten KI-Anwendungen wie ChatGPT, die die großen Werke der Antike – zum Beispiel – erstaunlich effizient zusammenfassen. Homers Odyssee – erklärt uns die Maschine auf eine entsprechende Anfrage in einer Sekunde, „vermittelt tiefgründige Lehren über die menschliche Natur, den Kampf gegen Widrigkeiten, die Rolle des Schicksals, die Bedeutung von Intelligenz und den Wert von Treue und Familie. Sie zeigt, dass der Weg zum Ziel oft lang und schwierig ist, dass jedoch Ausdauer, List und Mut letztendlich zum Erfolg führen.“
In Griechenland warten über 55 Millionen Dokumente auf ihre komplette Digitalisierung. Darunter sind historische Akten mit nationaler Bedeutung, aber auch Sammlungen persönlicher Daten von Bürgern. In Athen werden Suchmaschinen mit Künstlicher Intelligenz kombiniert, sodass gezieltere, schnellere und effektivere Suchen möglich sein werden. Die Schattenseite: Die KI-Systeme halluzinieren, lügen gelegentlich und haben kein echtes Weltverständnis. „Damit ist die Leistung der großen Sprachmodelle zwar besser als bei bloßem Raten, sie liegt aber deutlich unter dem Niveau eines Geschichtswissens auf Expertenniveau“, konstatieren die Forschenden vom Clomplexity Science Hub in Wien. Das Rätsel Griechenland bleibt selbst für eine allwissende Technik ungelöst.
Literatur:
Karl Heinz Ott, Hölderlins Geister, Hanser Verlag, München 2019
Rüdiger Safranski, Hölderlin, Hanser Verlag München 2019
Klaus Werner Haupt, Johann Winckelmann, Weimarer Verlagsgesellschaft, Weimar 2014
Patrick Leigh Fermor, Mani, Dörlemann Verlag,Zürich 2011