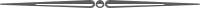Die Gärten der Welt
Im April stimmten uns, angesichts der tristen Bilder aus der Ukraine, die Grautöne. Das Wetter, in diesem Monat kalt und unbeständig, erinnerte an die Italiensehnsucht Goethes, der, von einem Burnout geplagt, zwei Jahre in den Süden reiste. „Wenn das Barometer tief steht und die Landschaft keine Farben hat, wie kann man leben?“ klagte Goethe. In Berlin suchten wir im Botanischen Garten in Stieglitz und in den „Gärten der Welt“ in Marzahn nach Ablenkung und Inspiration.
Es war dabei verschiedene Bücher, die uns den Weg für einen Stimmungswechsel eröffneten. Ernst Jünger wurde, wegen seiner Tagebücher „unter Stahlgewitter“, die seine Erfahrungen im 1. Weltkrieg zum Thema beschrieben, ein berühmter Kriegsschriftsteller. Sein eigentliches Lebenselement war jedoch die Natur. Der Sammelband „geheime Feste“ führt in seine Reiseliteratur ein und zeigt den Meister der genauen Beobachtung von Landschaften, Pflanzen und Tieren.
Das dynamische Geschehen in der Natur tröstet ihn über die menschlichen Abgründe hinweg: „Und ich dachte mir, daß, wenn diese Wut zu leben und zu wachsen, für unsere Ohren vernehmbar wäre, sich hier ein Getöse erheben würde, das auch die größte Schlacht der Menschen übertönen müsste“.
Gerne besuchte der Schriftsteller den botanischen Garten in Berlin mit der Absicht seinen Wort- und Erfahrungsschatz auszubauen. „Da vor jedem Gewächs ein Schildchen im Boden steckte, dass seine Art und seine Heimat verriet, prägte sich dabei mühelos eine Fülle von Namen ein. Es blieb nicht aus, daß manche Erscheinung den Geist besonders beschäftigte.“ Jeder Mensch hat, aus Sicht des Dichters, nicht nur sein Sternzeichen und sein Wappentier, sondern auch seine Blume, seinen Baum seine Frucht. „Es gibt hier ein Entzücken, zu dessen Erklärung Duft und Farbe nicht genügen, es muß auf Verwandtschaft beruhen“.
Wir wanderten staunend durch die ungeheure Vielfalt dieser Pflanzenwelt mit über 20.000 Arten. Und wieder begegnet man hier, trotz aller Farbenpracht, den Grautönen. Ein Ziel der Einrichtung ist, wie man auf einigen Tafeln liest, die Dokumentation bedrohter Arten im Zeitalter globaler ökologischer Zerstörung. Viele Wunder der Schöpfung werden nur im Museum überleben.
In den Gärten der Welt hat der Besucher die Möglichkeit, auf einem Ausstellungsgelände, internationale Gartenkunst zu erleben. Der Park gewährt Einblicke in verschiedene Kontinente, Epoche und Kulturkreisen, vom asiatischen Raum über den vorderen Orient bis nach Europa. Auf dem Rundgang, im Hintergrund die großen Wohnsilos des Berliner Stadtteils Marzahn, laden, zum Beispiel die Kopien koreanischer und chinesischer Gärten, zum Nachsinnen über das Verhältnis von Natur und Philosophie ein.
In seinem Tagebuch „Lob der Erde“ setzt sich Byung-Chul Han intensiv mit der Symbolik der Pflanzenwelt auseinander. Der in Berlin lebende Philosoph nimmt den Leser auf eine Reise in sein privates Kleinod mit. Für den denkenden Menschen ist der Garten zu Hause, in jeder Jahreszeit, ein Gleichnis, reich an Sinnlichkeit und Materialität und – im Vergleich zu den Bildschirmen – unendlich welthaltiger. Han: „Angesichts der Digitalisierung der Welt täte es not, sie zu reromantisieren, die Erde, ihre Poetik wiederzuentdecken, ihr die Würde des Geheimnisvollen, des Schönen des Erhabenen zurückzugeben“. Han erklärt einfühlsam, dass wir die Ehrfurcht vor der Erde verloren haben und wir mühsam lernen zu sehen und hinzuhören.
Das Gefühl, das hier beschrieben wird, beschäftigte die Gelehrten. Alexander von Humboldt schrieb Goethe nach Weimar: „Denn die Natur muß gefühlt werden, wer sie nur sieht und abstrahiert, kann (…) Pflanzen und Tiere zergliedern (…) er wird ihr aber selbst ewig fremd bleiben.“
Ob die Nähe zur Natur in den Weltgärten Berlins zu erfahren ist, oder eine Illusion bleibt, verweist auf eine offene Frage der Erkenntnis. Goethe hatte auf seiner italienischen Reise den ersten botanischen Garten, gegründet im 16. Jahrhundert, in Padua besucht. Die Betrachtung einer Palme regte den Naturwissenschaftler an, über die Möglichkeit einer Urpflanze nachzudenken. Ein Gedanke, den ihn nicht mehr los lies. Aus den Gärten von Palermo berichtet er am 17.4.1787 von der Logik seiner Suche: „Woran würde ich sonst erkennen, daß dieses oder jenes Gebilde eine Pflanze sei, wenn sie nicht alle nach einem Muster gebildet wären?“
Die neuen Weltgärten, mit ihren ausgestellten Gewächsen aus aller Welt, empfand Goethe, Dichter und Naturwissenschaftler in einer Person, im Sinne einer Herausforderung. „Gestört war mein guter poetischer Vorsatz… ein Weltgarten hatte sich aufgetan“ schrieb er über eine der Ur-Szenen der Moderne. Nicht die Poesie des Herzens, sondern die Prosa der wissenschaftlichen Erkenntnis eröffnete den Zugang zu dieser künstlichen Welt. An die Stelle von Mythos und Poesie tritt die Naturforschung, die Archivierung allen Lebens, mit dem Übervater Linné auf der Hinterbühne. Goethe sah die Ambivalenz des Prozesses, die entzauberte Wirklichkeit, die ökonomische Dynamik der Globalisierung und die aufkommende Macht der Naturwissenschaften.
Literatur:
Ernst Jünger, Geheime Feste, Klett-Cotta
Byung Chul Han, Lob der Erde, Eine Reise in den Garten, Ullstein Verlag
Stefan Bollmann, Der Atem der Welt, Klett-Cotta
Stefan Rebenich, Der kultivierte Gärtner, Die Welt, die Kunst und die Geschichte im Garten, Klett-Cotta