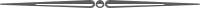Im Elsass ist es kalt und regnerisch. Wir besuchen das Museum „Würth“ in Erstein, Teil der französischen Dependance des Weltunternehmens. Hier wird in einem modernen Gebäude zeitgenössische Kunst ausgestellt. Der aus einfachen Verhältnissen stammende Reinhold Würth beschäftigt heute bei einem Umsatz von 13.6 Milliarden weltweit 77000 Mitarbeiter. Schrauben und Befestigungssysteme ließen den genialen Geschäftsmann reich werden und ermöglichten ihm, einen gewaltigen Kunstschatz anzuhäufen. In mittlerweile 14 Ausstellungsstätten im In- und Ausland werden die mehr als 18000 Werke bei freiem Eintritt in permanenten Wechselausstellungen gezeigt.
Die aktuelle Ausstellung ist der „Art brut“ gewidmet. Der Begriff führt zu dem Maler und Schriftsteller Jean Dubuffet, der nach dem 2. Weltkrieg einen neuen, erweiterten Kunstbegriff schuf. Neben der eigenen Praxis beschäftigte er sich mit dem Werk von Geisteskranken, Produktionen aller Art – Zeichnungen, Gemälde, Stickereien, modellierte geschnitzte Figuren. Diese Kunst hat einen spontanen und erfinderischen Charakter. Seine Kunstsammlung setzt sich von üblichen Vorstellungen des Kunstbetriebes oder kulturellen Klischees ab. Die Werke stammen von verworrenen und randständigen Personen, die nicht in professionellen Kunstkreisen tätig sind. Ein in seinem Sinne Kunstschaffender muss nach der Definition Dubuffet`s emotional, sozial und wirtschaftlich isoliert sein und darf keine offizielle Anerkennung oder den Status eines Künstlers anstreben.
In Erstein bewundert man Schöpfer von Kunstwerken, die mit ungewöhnlichen Biographien auffallen: zum Beispiel der Amerikaner Henry Darger. Er ist 4 Jahre alt, als seine Mutter stirbt. Er kommt in ein Heim, dann in eine Anstalt für geistig zurückgebliebene Kinder, von wo er mit 17 wegläuft. Ab 1920 arbeitet er als Putzmann in einem Krankenhaus in Chicago. Nichts in seiner beruflichen Laufbahn deutet auf das faszinierende Werk hin, das am Ende seines Lebens in einem Zimmer entdeckt wird. Eines seiner ausgestellten Bilder zeigt eine Ikone des Fortschritts, eine dampfende Eisenbahn und eine Gruppe von bunt gekleideten Tänzerinnen, die vor dem Ungetüm über die Schienen laufen.
Eine Abteilung ist besonderen KünstlerInnen gewidmet. Die meisten Schaffenden sind hier Autodidakten. Sie folgen einer Praxis, die auf keiner Schule beruht, die nur sich selbst einbringt und grenzenlose Phantasie andeutet. Das berühmte Postulat des Beuys aus den 1960er Jahren findet hier seine Bestätigung: „Jeder Mensch ist ein Künstler“.
Ausgestellt wird zum Beispiel ein Werk von Paul Amar aus dem Jahre 1985. In einem Glaskasten zeigt sich ein religiöser Tempel, zufällig entstanden aus Gegenständen, aus Muscheln, die der Künstler in einem Geschäft entdeckte. Flugs verwandelt er daraufhin seine Pariser Sozialwohnung in ein Künstleratelier.
Vielsagend sind die ausgestellten Werke spiritistisch beeinflusster Kunst, deren Schaffensgeschichte Augustine Lesage wie folgt beschreibt:
„Ich mache alle meine Bilder ohne sie zu konzipieren. Ich zeichne nichts auf, ich haben keine andere Werkzeuge als meine Pinsel und Schaufeln. Eine unsichtbare Kraft zwingt mich, eher die Farbe als eine andere zu nehmen. Ich male nur mit Öl und kein anderer Einfluss, als der mich führt, kann auf meinen Arm einwirken.“
Wir sind begeistert, verwundert, dass ein Unternehmer, der mit seiner strengen Geschäftsführung beeindruckt und mit ausgeklügelten, technischen Systemen brilliert, gleichzeitig „surreale“ Räume schafft, die er einer breiten Öffentlichkeit zugänglich macht. Im Museumscafé blättern wir durch die Biografie über den „Herrn der Schrauben“. Die Lebensgeschichte von Reinhold Würth stellt eine ungewöhnliche Symbiose dar: Erfinder, Geschäftsmann und Kunstliebhaber.
Literatur:
Helge Timmerberg, Reinhold Würth – der Herr der Schrauben, Piper Verlag, München 2020