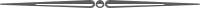Wir stellen unseren Hausschuh auf dem Dorfplatz von Illiers-Combray ab. Nichts deutet darauf hin, dass es hier etwas zu sehen gibt. In dem verschlafenen Nest erfährt man von den Dramen der Welt aus der Zeitung. Es ist heiß und wir setzen uns in einem hübschen Lokal vor der Kirche in den Schatten. Der Kaffee wird uns mit einer Madeleine gereicht, einem süßen Kuchen aus einem mit Butter verfeinerten Biskuit-Teig.
Das süße Stückchen ist ein Schlüsselmotiv aus dem grandiosen Roman von Marcel Proust und seiner Suche nach der verlorenen Zeit. Der Erzähler taucht die Madeleine in eine Tasse Tee ein und versinkt – es ist wohl der Geschmack der Süßspeise – in Erinnerungen an seine Kindheit. Der Madeleine-Effekt – die Kommunikation eines Objektes oder eines Geschmackes mit dem Unterbewusstsein des Betrachters, wird bald zum Gegenstand psychologischer Forschung.
Wir versuchen uns, an die komplizierte Struktur des Romans zu erinnern. Das ist nicht einfach, da es im Grunde keine große Handlung gibt, dafür detaillierte Schilderungen von Orten, Dingen, Menschen und den Zusammenkünften des Bürgertums und des Adels in den Salons der Hauptstadt. Die vor uns liegende Kirche schildert der Schriftsteller in einmaligen Stil, wobei, wie man hier feststellt, der eher unscheinbare Bau mit den fiktiven Erinnerungen an viele andere Kirchen ergänzt wurde.
Proust schreibt in seinem Roman über das Dorf:
„Combray, von ferne gesehen, aus einem Umkreis von zehn Meilen, von der Eisenbahn aus…war nur eine Kirche, die die Stadt zusammenfaßte, die sie vertrat, die zu der Ferne von ihr und für sie sprach und die, wenn man näher kam, um ihren hohen düsteren Kragenmantel herum mitten im Feld gegen den Wind wie eine Hirtin ihre Schafe die wolligen, grauen Rücken der zusammengescharrten Häuser dicht beinander hielt, die einen Rest der Stadtmauer aus dem Mittelalter hier und da mit einer vollkommenen kreisrunden Linie umgab wie auf einem spätgotischen Bild“.
Die ganze Themen-Landschaft des Romans, ausgelöst durch die Kindheitserinnerungen, beginnt an diesem verlassenen Ort. Proust schafft hier zwei Welten, die sich dem Leser durch zwei Spaziergänge erschließen, die Welt der Familie der Guermantes und die Welt des Swanns. Im späteren Verlauf des Werkes wird Marcel, der Erzähler im Buch, die Schicksale der interessantesten Charaktere verfolgen und die Atmosphäre ihrer gesellschaftlichen Ereignisse in Paris oder im Urlaub in dem Badeort Cabourg schildern.
Das Lesen des Romans erfordert eine gewisse Geduld. Wir sind kaum noch gewohnt, auf Dutzenden Seiten über die Anordnung eines Teeservices oder die Gesichtszüge einer Person zu erfahren. Wer sich aber an den Stil gewöhnt wird beschenkt und zweifellos eine neue Art der Meditation entdecken. Die Langsamkeit der Erzählung, der Zauber von Erinnerungen, das Eintauchen in fremde Charaktere, lassen den Leser tief in diese Phantasielandschaft eintauchen.
Auch bei unserem Besuch, in der Mittagshitze von Combray, fern der gewöhnlichen Touristenströmen, bedarf es der Erinnerung und der Fiktion, um die versteckten Reize dieses Ortes zu entdecken. Das kleine Museum im Haus der Tante Leonie ist wegen Renovierung geschlossen und wir wandern zurück zum temporären Ort der Ausstellung am anderen Ende des Dorfes. Die Straßen sind leergefegt, das Museum wenig spektakulär. Die versammelten Werke Proust´s sind dort auf einigen Tischen ausgelegt. C´est tout.