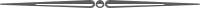László Krasznahorkai, 1954 in Ungarn geboren, wurde 2025 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet — eine Anerkennung für sein „überzeugendes und visionäres Werk, das inmitten apokalyptischer Schrecken die Kraft der Kunst bekräftigt“. Wir lesen während der dunklen Herbstzeit eines seiner Werke, Krieg und Krieg, und entdecken darin eine ganz andere Form des Reisens. Das Buch erzählt die Geschichte eines Archivars, Korin, der in einem verstaubten Archiv der ungarischen Provinz ein geheimnisvolles Manuskript findet.
Im Manuskript, das Korin liest, tauchen vier geheimnisvolle Reisende auf. Sie streifen durch unterschiedlichste Städte und Zeiten – von antiken Schauplätzen über verwüstete Landschaften bis in moderne Metropolen. Die Welt, durch die sie ziehen, ist überall von Konflikten, Unruhe und Übergangssituationen geprägt. Die vier beobachten, notieren, bezeugen. Sie sind wie Wanderer nach einer Apokalypse: nie ganz angekommen, immer weitergezogen, als würden sie nach einem Ort suchen, an dem die Welt endlich zur Ruhe kommt. Unterwegs begegnen sie Kriegen, politischen Umbrüchen, Menschengruppen auf der Flucht und immer wieder Momenten beinahe überirdischer Stille. Doch eine klare Mission haben sie nicht – ihre Reise ist eher eine Suche nach Sinn inmitten des Chaos. Sie versuchen, die Welt zu verstehen, ohne dass sie je durchschaubar wird. Und gerade dieses fortwährende Unterwegssein macht das Manuskript zu einer Art existenzieller Reiseliteratur: ein Trip durch die Bruchzonen der Geschichte, bei dem das eigentliche Ziel die Suche selbst bleibt. Diese vier Reisenden sind offensichtlich keine Helden, keine Abenteurer, sondern eher Schatten, die ihre allegorische Bewegung fortsetzen müssen, weil der „ewige Krieg“, der überall herrscht, sie niemals loslässt.
Für Korin ist dieser Fund eine Offenbarung – ein Text einer geheimnisvollen Ordnung, die seiner eigenen, von Chaos bedrängten Welt völlig entgegensteht. In dem Moment, in dem er das Manuskript entdeckt, beginnt seine eigene Odyssee, eine Reise, die ihn fortträgt, obwohl er keinen Ort mehr kennt, an den er zurückkehren könnte. Korin empfindet den Zustand der Welt als einen permanenten, nie endenden Krieg, der nicht allein in politischen Katastrophen liegt, sondern in den Strukturen des Daseins selbst. Nichts harmoniert, nichts ist gesichert, und selbst das eigene Denken wird von dieser Weltlage gezeichnet. Dass seine Reise in die Ferne führt, hat deshalb weniger mit Neugier zu tun als mit einer unumgänglichen Notwendigkeit.
Als er Ungarn verlässt, verlässt er nicht einfach einen Ort, sondern einen Zustand, den er nicht länger aushält. Der Schritt hinaus ist gleichermaßen Flucht und Geste der Hingabe an etwas Größeres: an die Idee, dass das Manuskript gerettet werden muss, dass es im Chaos der Welt eine Spur von Ordnung geben könnte, die nicht verloren gehen darf. In New York, wohin er sich als Nächstes wendet, scheint zunächst alles möglich. Die Stadt ist laut, schnell, überlädt jeden Sinn, und inmitten dieses Übermaßes hofft Korin, dem Manuskript eine Art digitale Ewigkeit schenken zu können. Er möchte es ins Internet stellen, einschreiben in jenes unerschöpfliche Archiv, das für ihn anfangs, wie ein moderner Himmel wirkt.
Doch Krasznahorkai zeigt, wie brüchig diese Hoffnung ist. Die Ewigkeit des Netzes ist keine wahre; sie ist porös, zufällig, anfällig für das gleiche Chaos, das Korin aus Ungarn fortgetrieben hat. Nichts, was dort steht, ist gesichert. Alles kann gelöscht, überschrieben, vergessen werden. New York wird deshalb nicht zu einem Ort des Ankommens, sondern zu einer Durchgangslandschaft, die der Autor mit surrealen Frequenzen auflädt.
Nach seinem Aufenthalt in New York reist er nach Schaffhausen. Diese ruhige, beschauliche Stadt am Rhein wirkt auf Korin wie ein Ort, den die Welt vergessen hat. Und doch reist er genau dorthin, um ein Kunstwerk zu sehen, das ihm wie ein Leuchtfeuer erscheint: ein Iglu des Turiner Künstlers Mario Merz. Die Iglus von Merz sind seit Jahrzehnten Symbole nomadischer Existenz, temporäre Behausungen, die in ihrer archaischen Form eine Klarheit ausstrahlen, die den Menschen zugleich schützt und entblößt. Die Kombination aus Glas, Stein, Metall und den intuitiven Spiralen der Fibonacci-Zahlen verwandelt das Iglu in ein mathematisch-archaisches Gedicht. Für Korin, dessen ganze Reise von der Suche nach Ordnung inmitten eines metaphysischen Sturms geprägt ist, erscheint dieses Iglu wie der mögliche Endpunkt eines langen Weges. Vielleicht ist es der einzige Ort, an dem die Struktur der Welt – oder zumindest die Struktur eines Gedankens über die Welt – kurz sichtbar wird. Aber auch hier bleibt die Frage offen, ob dieser Ort tatsächlich Halt gibt oder lediglich die letzte Illusion eines müden Reisenden ist.
Korin reist nicht, um Neues zu entdecken, sondern um etwas zu bewahren. Er reist nicht, um anzukommen, sondern weil Stillstand nicht mehr möglich ist. Seine Reise hat kein Ziel, das sich in einer Karte einzeichnen ließe, und kein Zuhause, das auf ihn wartet. Es ist eine Odyssee ohne Ithaka, ein unaufhörliches Weiterziehen, das ihn der Welt nicht näherbringt, sondern ihrer Wahrheit: dass es keine garantierten Orte gibt, keine wirklichen Sicherheiten, keine dauerhaft bewohnbaren Häfen. Und genau darin liegt die merkwürdige, moderne Stimmung dieses Buches.
Warum trifft Korin am Ende des Buches auf die Kunst von Mario Merz? Beide sprechen von einem Nomadentum, das nicht romantisch verklärt ist, sondern existenziell. Das Iglu in Schaffhausen wirkt wie ein stilles Monument für Menschen, die unterwegs sind, weil sie es sein müssen. Es erinnert daran, dass selbst jene, die nicht zurückkehren können, doch eine Form der Behausung suchen – einen Ort, der sie für einen Moment aus dem Wind nimmt.
So wird Krieg und Krieg zu einer Art Gegenentwurf zur klassischen Reiseliteratur. Korins Weg ist kein Weg der Entdeckung, sondern des Erkennens. Er führt durch reale Städte und gleichzeitig durch metaphysische Landschaften. Er zeigt, dass es Reisen gibt, die nicht die Welt vergrößern, sondern den Blick auf ihre Brüchigkeit schärfen. Und während Korin sich weiterbewegt, von Ungarn über New York bis nach Schaffhausen, wird klar: Manchmal ist das Reisen nicht das Hinausziehen in die Ferne, sondern das langsame Begreifen, dass es keinen endgültigen Ort gibt, an dem man bleiben kann.
Manche Wege enden nicht. Wir suchen nach einer Heimat. Und doch gehen wir weiter.
Literatur: Laszlo Krasznahorkai, Krieg und Krieg, Fischer Verlag 2025