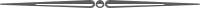Im griechischen Olympia gibt es in der touristisch geprägten Hauptstraße einen Buchladen. Unter den Klängen einer Sinfonie von Beethoven stöbern wir in der Abteilung für englische und deutsche Bücher, bis uns der Eigentümer entdeckt. Wir kommen ins Gespräch und wir erzählen ihm von unserer Reise. „Reisen!“, seufzt er und zuckt mit den Achsen, „ist eine Bewegung, von der ich lebe, aber ich erwarte davon nichts mehr. Zu viele Leute sind heutzutage unterwegs, um zu erfahren, dass alle gleich sind!“ Wir kaufen ein Buch bei ihm und bezahlen. Zum Abschied drückt der Buchhändler uns einen deutschen Text, mit dem Titel „die Monotonisierung der Welt“, in die Hand und wendet sich dann wieder seiner Wirklichkeit zu.
Im Café lesen wir das uns überlassene Dokument aus dem Jahr 1925, geschrieben vom österreichischen Schriftsteller Stefan Zweig. Vor beinahe hundert Jahren beklagte er, trotz aller Beglückung des Reisens an sich, ein leises Grauen vor der Monotonisierung der Welt. „Alles wird gleichförmiger in den äußeren Lebensformen, alles nivelliert sich auf ein einheitliches kulturelles Schema. (…) Immer mehr scheinen die Länder gleichsam ineinander geschoben, die Menschen nach einem Schema tätig und lebendig, immer mehr Städte einander äußerlich ähnlich.“ Er fragte sich nach dem Ursprung der Welle, die alles Farbige, alles Eigenförmige aus dem Leben wegzuschwemmen droht.
Stefan Zweig war ein großer Schriftsteller mit einem tragischen Schicksal, aber der Grundaussage des Textes – die wahrscheinlich auch den Buchhändler überzeugte, stimmen wir nicht zu. Auf unserer Reise durch Kroatien, Bosnien, Montenegro, Albanien und Griechenland lernten wir zu unterschiedliche Regionen kennen, die aus vielen Gründen auch große Unterschiede – im Kulturellen, Religiösen und Politischen – aufweisen. Dabei ist uns natürlich nicht entgangen, dass die Gewohnheiten des Konsums, des Tourismus und die Rolle der Smartphones sich an vielen Orten gleichen.
Olympia ist vermutlich einer der Höhepunkte jeder Griechenlandreise. Im November wandern wir unter der Herbstsonne einsam durch die Anlagen. Und ja, man spürt den Geist vergangener Tage. Wir fragen uns, was für ein Menschentypus die Griechen waren, die hier in Harmonie mit ihren Göttern lebten. Die Geschichte der Spiele wird auf das Jahr 776 vor Christus datiert. Mitte des 5. Jahrhunderts bot das Stadion 45.000 Zuschauer Platz. Legendär ist bis heute der heldenhafte Status der Sieger der verschiedenen Wettbewerbe.
Vor einem Jahr standen wir in Lausanne am olympischen Feuer vor dem Denkmal des französischen Pädagogen, Historiker und Sportfunktionär Pierre de Coubertin (1863-1937). Er war überzeugt, dass in der Erziehung neue Wege unerlässlich seien und die sportliche Ausbildung den ganzen Menschen in der Einheit von Körper, Geist und Seele erfassen soll. Sein Credo: „Das Wichtigste im Leben ist nicht der Sieg, sondern der Kampf, das Wesentliche ist nicht, gewonnen zu haben, sondern gut gekämpft zu haben.“
Unter dem Eindruck der Ausgrabungen in Olympia trat er für die Wiederbelebung des Ereignisses ein und gründete 1894 das Internationale Olympische Komitee. Nötig war zunächst ein Gestaltwandel: Die alten Griechen hatten kein Konzept von „Sport“, der Wettkampf diente ursprünglich der körperlichen Ertüchtigung der Soldaten und dem Lob der Götter. Die Sieger erhielten einen Olivenzweig als Symbol des Respektes und der Anerkennung.
Die moderne olympische Idee widersetzte sich nationalen Egoismen und trug zum Frieden und zur internationalen Verständigung bei. Dass diese Mission nicht einfach war, zeigte sich an der Vergabe der Veranstaltung in den 30er Jahren. Von einem französischen Journalisten gefragt, warum er die Berliner Nazi-Spiele unterstütze, antwortete Coubertin, das Wichtigste sei, dass sie grandios gefeiert würden. Dabei sei es egal, ob man sie als Tourismuswerbung für Südkalifornien wie 1932 oder als Werbung für ein politisches System wie 1936 verwende. In den letzten Jahrzehnten ist es vor allem die Kommerzialisierung der Spiele, die die Idee verändert.
Die Lebensreformbewegung der Jahrhundertwende verwandelte den Sport zum modernen Massenphänomen. Die geistigen Hintergründe der Körperertüchtigung nehmen einen prominenten Platz in Peter Sloterdijks Buch „Du musst Dein Leben“ ändern ein. Der Philosoph zeichnet die Entwicklungsgeschichte der Spiele im Licht ihres antiken und religiösen Vorbildes nach. Er schreibt über die profane Realität des Sportes in der Moderne, zwischen Selbstoptimierung, Kommerz und Massenmobilisierung. Sein Fazit: „Die olympische Idee hat nur als säkularer Kult ohne ernstgemeinten Überbau überleben können.“
Der athletische Imperativ, der das ganze 20. Jahrhundert durchhallt, ist für den Philosophen von großer alltäglicher Bedeutung: „Überall, wo dieser Imperativ vernommen wird, sind wir kulturell auf der richtigen Seite, weil wir dann im griechischen Raum bleiben, in dem der Sport als eine Angelegenheit der Schönheit betrieben wird.“ Nur, wer denkt im Fitnessstudio oder auf der Laufstrecke über den antiken Ursprung unserer Körper-Ideale nach?
Im Museum in Olympia, das die Geschichte der Stätten erzählt, lässt sich schon in der alten Zeit ein Gestaltwandel ablesen. Im Ursprung gab es keine Dialektik zwischen dem Heiligen und dem Profanen und – in der Logik der allgegenwärtigen Götter – existierte ein säkularer Raum nicht. Im weiteren Verlauf, etwa im 4. Jahrhundert vor Christus, beobachtet man in den olympischen Anlagen den Beginn einer immer klareren Trennung zwischen den Tempeln und den Sportstätten.