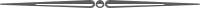Letztes Wochenende waren wir in Sellin im Schneeregen unterwegs. Der Wind schneidend. Die Natur, sonst eine Inspirationsquelle für uns, war in ein unzugängliches Grau entrückt. Stumm blickten wir auf das regungslose Meer. Das Panorama mit der Seebrücke wirkte wie ein Porzellanteller an einer sonst leeren Wand. Kein Austausch, keine Stimmung – es war einer dieser Wintertage, die ohne nachhaltige Eindrücke vergehen. Wir flüchteten vor dem Wetter, vor uns selbst und den Gedanken, die sich in diesen Lagen gerne einschleichen.
Allein Trost spendet der Gedanke, dass derartige Ausflüge vermutlich zur Vorbereitung dienen, um an einem anderen Tag wieder das Fest von Licht und Sonne, in seiner ganzen Wirkung erfahren zu können.
Zu Hause blättern wir in dem Klassiker „Der Zauberberg“ (1924) von Thomas Mann und finden dort ein ganzes Kapitel mit der passenden Überschrift: Schnee.
Der Roman erzählt das Schicksal von Hans Castorp, der, obwohl zunächst nicht ernsthaft erkrankt, in einem Sanatorium in den Schweizer Bergen langsam die Zeit vergisst. Der Held der Geschichte verbleibt schließlich sieben Jahre in der illustren Gesellschaft der Patienten des Berghofes. Der Kurort Davos wird zur Bühne für die europäische Befindlichkeit vor dem 1. Weltkrieg.
Thomas Mann beschreibt seitenlang, gewohnt meisterhaft, die Atmosphäre des Winters. An diesen Tagen sind die Patienten unruhig geworden, denn es waren „gewaltige Ausfälle an Sonne zu verzeichnen, an Sonnenstrahlung, diesem wichtigen Heilfaktor, ohne dessen Mithilfe die Genesung sich zweifellos verzögerte…“
Castorp liebt den Schnee und die Ur-Monotonie des Naturbildes, die er mit dem Meeresstrand und dem Sand vergleicht. Er entschließt sich zu einem Ausflug, der ihn tiefer in die Bergwelt, eine Landschaft, die in ein trübes, wattiges Nichts gehüllt ist, führt. In einem Schneesturm erfährt der Wanderer das reine Nichts, „das weiße, wirbelnde Nichts“ und in Sichtweite gespenstische Schatten der Erscheinungswelt.
Zu einer Rast gezwungen beginnt er zu träumen, zunächst von seiner Heimat, dann von einer Bucht am blauen Meer, an denen die „Sonnenleute“ verkehren. Seine imaginäre Reise führt ihn weiter bis zu den Tiefen des Paradieses, des Totenreiches und der Natur.
Als er aufwacht, kreisen seine Gedanken über den Tod und das Leben. „Der Mensch ist Herr der Gegensätze, sie sind durch ihn, und also ist er vornehmer als sie“ geht ihm durch den Kopf. „Ich will dem Tode keine Herrschaft einräumen über meine Gedanken“ beschließt er. Und: „Die Liebe steht dem Tod entgegen, nur sie, nicht die Vernunft, ist stärker als er.“
Erstaunlich schnell vergisst der Protagonist, im weiteren Verlauf der Erzählung, diese Einsichten, bevor ihn Thomas Mann nach dem Donnerschlag des Kriegsbeginns aus dem Sanatorium entlässt. Seine Spur verliert sich in den Wirren des Weltkrieges.
Im Nachgang kommentierte Mann selbst, dass er das Schneekapitel für den Schlüssel zum Verständnis seines Romans hält:
„Wenn ich einen Wunsch für den Nachruhm meines Werkes habe, so ist es der, man möge davon sagen, dass es lebensfreundlich ist, obwohl es vom Tod weiß. Ja, es ist mit dem Tode verbunden, es weiß von ihm, aber es will dem Leben wohl. Es gibt zweierlei Lebensfreundlichkeiten: eine, die vom Tod nichts weiß; die ist recht einfältig und robust, und eine andere, die von ihm weiß, und nur diese, meine ich, hat vollen geistigen Wert. Sie ist die Lebensfreundlichkeit der Künstler, Dichter und Schriftsteller.“
Literatur:
Thomas Mann, Der Zauberberg, Fischer Verlag, Frankfurt 2004